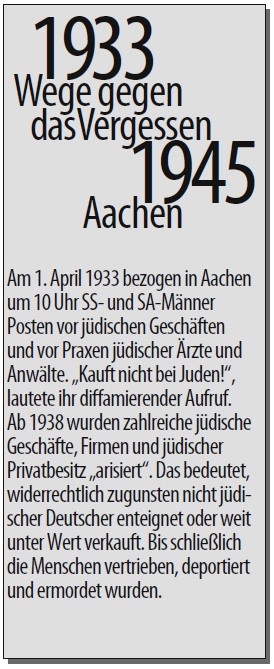Aktuelles
Mord an zwei Kindern
Seit der Landung der Alliierten Truppen in der Normandie im Juni 1944 rückte die Front immer weiter auf Deutschland zu. Die erste größere deutsche Stadt, die sie erreichen würden, war Aachen.
Am 11. September 1944 gab die Nazi-Führung in Aachen den Befehl, dass die Zivilbevölkerung die Stadt verlassen musste. Diese Evakuierung lief schleppend an, da der Transport der Menschen schlecht organisiert war. Panik machte sich unter den Menschen breit, da mittlerweile auch Geschützdonner von der näher rückenden Front zu hören war. In dem Chaos verließen Parteiorganisationen und städtische Institutionen sukzessive die Stadt. Was aus den Menschen werden sollte, die noch auf dem West- und dem Hauptbahnhof auf ihre Evakuierung warteten, war ihnen egal. In dieser Situation übernahm die Wehrmacht in Form von Gerhard Graf von Schwerin am 13. September 1944 das Kampfkommando über die Stadt Aachen.
Er selbst berichtete der Wehrmachtführung über die Lage in der Stadt:
„Massenweise strömten die Menschen, zumeist Frauen mit kleinen Kindern und Säuglingen, einige zusammengeraffte Habseligkeiten auf Handkarren und Kinderwagen verstaut, auf den nach Osten und Nordosten hinausführenden Straßen in die Nacht hinaus, ohne zu wissen wohin, ohne Zweck, Ziel und Sinn, getrieben einzig und allein von wilder, panikartiger Furcht und wüsten Drohungen der Partei, dass jeder, der nicht sofort die Stadt verließe, als Landesverräter erschossen werden würde.“
Weil er Angst hatte, dass diese Panik auch auf seine Soldaten übergreifen könnte und die Menschen auf den Straßen seine Truppen behindern könnten, ließ er hart Durchgreifen. Zum Beispiel gab er den Befehl, Plünderer standrechtlich abzuurteilen.
Zwei Jungen aus Aachen, beide 14 Jahre alt, wurden Opfer dieses Befehls. Soldaten hatten sie in der Innenstadt zusammen mit zwanzig Erwachsenen aufgegriffen. Unter dem Vorwurf, sie seien Plünderer, wurden nur die beiden unschuldigen Jungen vor ein Standgericht gestellt und in der Nähe des Bunkers am Veltmannplatz unter öffentlicher Beteiligung erschossen.
2002 wurde eine Gedenktafel zur Erinnerung an das Schicksal der beiden Jugendlichen am Bunker in der Saarstraße angebracht. Nachdem 2004 auf Antrag von Angehörigen der beiden Jugendlichen die Staatsanwaltschaft Aachen das Standgerichtsurteil aufgehoben hatte, rehabilitierte 2006 das Bundesverfassungsgericht die beiden unschuldig erschossenen Jugendlichen.
Bereits 2005 war die alte Gedenktafel wegen möglicher falscher Interpretation des Textes abgenommen worden. Eine neue Gedenktafel mit klarstellendem Text wurde 2006 wieder an der ursprünglichen Stelle angebracht.
Ergänzende Literatur:
Quadflieg, Peter M.: Gerhard Graf von Schwerin (1899 - 1980). Wehrmachtgeneral, Kanzlerberater, Lobbyist, Paderborn 2016.
Baumann, Guido; Bönnemann, Otto; Meven, Walter: Die Tragödie von Aachen. Die Hinrichtung von zwei Kindern, Erlangen 2003.


Enteignung und 'Arisierung'
Am 1. April 1933, einem Samstag, riefen die Nationalsozialisten in ganz Deutschland zu einem Boykott jüdischer Geschäfte, Anwälte und Ärzte auf. Boykott bedeutete, dass an diesem Tag niemand in die Geschäfte oder Praxen jüdischer Inhaber gehen sollte. Auch in Aachen führte die SA (Sturmabteilung) unterstützt durch die Hitlerjugend die Boykott-Aktion durch. Die nicht-jüdischen Aachener*innen sahen den Aktionen zumeist tatenlos zu, auch wenn sie vielleicht nicht damit einverstanden waren. An die Fensterscheiben der betroffenen Geschäfte malten SA- und SS Davidsterne. Vor den Eingängen standen Hitler-Jungen Posten mit Schildern, auf denen 'Kauft nicht bei Juden' oder 'Wer noch bei Juden kauft, wird kostenlos fotografiert' zu lesen war. Damit wurden die meisten Aachener eingeschüchtert, denn man konnte nur ahnen, was dann mit den Fotos passieren würde. Dennoch blieb an den meisten Orten der gewünschte Erfolg der antisemitischen Boykottmaßnahme aus: Viele Menschen gingen trotz der Drohungen in die Geschäfte, häufig auch mangels Alternativen. Der April-Boykott wurde in Aachen nach einem Tag beendet und in dieser Form nicht mehr durchgeführt.
Der nationalsozialistische Staat begann jüdische Menschen formal-juristisch zu diskriminieren und ihnen die sukzessiv erkämpften Bürgerrechte der vorherigen Jahrzehnte abzuerkennen. Schon 1933 gab es 45 Reichsgesetze und Verordnungen, die in diskriminierender Weise die Stellung der “Nichtarier”, damit waren vor allem Juden gemeint, im Deutschen Reich neu festlegten. Aber das war nicht das einzige. Im Laufe der dreißiger Jahre gab es immer wieder Ausschreitungen gegen Juden und heftige Propagandakampagnen.
In Tageszeitungen wie dem „Westdeutschen Beobachter“ in Aachen wurden zum Beispiel im Frühjahr 1934 Pläne der wichtigsten Geschäftsstraßen veröffentlicht, in denen Geschäfte verzeichnet waren, die die Zeitung ihren Lesern besonders empfehlen wollte. Die Geschäfte jüdischer Inhaber waren besonders markiert, mit der Aufforderung, dort nicht zu kaufen.
Jüdisches Leben sollte aus der Öffentlichkeit verdrängt werden, weshalb bis zur Reichspogromnacht die rechtliche Diskriminierung von Jüdinnen und Juden mit zunehmend mehr und mehr Gesetzen begleitet war. Ein bekanntes und frühes Beispiel für eine damals sogenannte 'Arisierung' ist die Leonard Tietz AG, die auch in Aachen am zentralen Marktplatz gegenüber vom Rathaus eine Filiale besaß. Die neuen Besitzer, alle den Nazis genehm, benannten das Unternehmen am 11. Juli 1933 in „Kaufhof AG“ um. Aber nicht alle Aachener*innen nahmen den Staatsantisemitismus an. In einem internen Schreiben der Staatspolizeistelle für den Regierungsbezirk Aachen heißt es für September 1935:
“Überhaupt ist das Verständnis der Bevölkerung für die Notwendigkeit der nationalsozialistischen Rassenpolitik [sic!] nur sehr gering. Wenn dazu nun noch von geistlicher Seite derartige Äusserungen zu diesem Thema fallen, so wird es schwer sein, die gläubigen Katholiken von der Notwendigkeit der Rassengesetzgebung [sic!] zu überzeugen. Vielmehr sieht ein erheblicher Teil der Bevölkerung als Massnahmen gegen die Juden als unchristlich und überflüssig an.” [1]
Tafeltext
Am 1. April 1933 bezogen in Aachen um 10 Uhr SS- und SA-Männer Posten vor jüdischen Geschäften und vor Praxen jüdischer Ärzte und Anwälte. „Kauft nicht bei Juden!“ lautete ihr diffamierender Aufruf. Ab 1938 wurden zahlreiche jüdische Geschäfte, Firmen und Privatbesitz „arisiert“. Das bedeutet, widerrechtlich zugunsten nicht jüdischer Deutscher enteignet oder weit unter Wert verkauft. Bis schließlich die Menschen selbst vertrieben, deportiert und ermordet wurden.
[1] Faust, Anselm; Rusinek, Bernd-A.; Dietz, Burkhard (Bearb.), Lageberichte rheinischer Gestapostellen. Band II, 2: Juli – Dezember 1935,
(= Publikationen der Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde, Bd. LXXXI), Düsseldorf 2015, S. 1058.
Ergänzende Literatur:
Faust, Anselm; Rusinek, Bernd-A.; Dietz, Burkhard (Bearb.), Lageberichte rheinischer Gestapostellen. Band II, 2: Juli – Dezember 1935,
(= Publikationen der Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde, Bd. LXXXI), Düsseldorf 2015.
Lorenz, Andreas: Arisierung und Wiedergutmachung. Ein Beitrag zur Geschichte der jüdischen Tuchfabrikanten Aachens, Aachen 2023.
Flucht und Fluchthilfe im Dreiländereck
Die Verfolgung politisch Andersdenkender und jüdischer Staatsbürger sowie aus ethnisch oder sozialen Gründen Verfolgter führte zu zahlreichen Flucht und Schmuggelaktivitäten an den Grenzen des Deutschen Reichs. Aachen als Grenzstadt und damit verbunden die grüne Grenze nach Belgien und den Niederlanden rückten in den Fokus für viele Menschen, die Deutschland nach 1933 verlassen mussten. Auch diente das nahe belgische und niederländische Ausland den Sozialdemokraten, Kommunisten und Gewerkschaftlern gerade in den Jahren bis 1940 als Basis für ihre Untergrundarbeit gegen das Regime im Inland.
Im Vergleich zu heute wurden damals die Grenzen wesentlich massiver kontrolliert. Kein Durchlass war ohne gültige Reisepapiere möglich. Scharfe Zollgesetze regelten den Devisen- und Warenverkehr. Die Grenzen trennten die Menschen und Kulturen. Warenschmuggel und illegaler Grenzverkehr waren seit vielen Jahren in Aachen ein bekanntes Phänomen. Die Untergrundorganisationen der verfolgten politischen Gruppierungen, Parteien und Gewerkschaften schmuggelten unmittelbar nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten Informationsmaterial (bspw. die im Ausland gedruckte Parteizeitung der SPD („Vorwärts“) nach Deutschland. Sie brachten mit ortskundigen Genossen verfolgte Genossen ins zunächst sichere Ausland. Die Flucht der politisch Verfolgten fand insbesondere in den Jahren 1933 – 1935 statt und wurde von der breiten Bevölkerung noch wenig bemerkt.
Je mehr sich die Terrorherrschaft etablierte und je deutlicher die Repressalien gegen die verfolgten Bevölkerungsgruppen wurden, desto schwieriger wurde der Schmuggel. Der Andrang insbesondere jüdischer Menschen, die Deutschland via Aachen Richtung Westen zu verlassen suchten, wuchs stetig. Ziel waren die jüdischen Zentren Belgiens und der Niederlande, Brüssel, Antwerpen und Amsterdam. Die Grenzkontrollen wurden verschärft, um insbesondere den illegalen „Abfluss“ von Devisen und mitgenommenen Wertsachen zu verhindern. Die Rassengesetze von 1935 legten fest, dass Juden, die noch mit legalen Papieren Deutschland verlassen wollten, maximal 10 RM auf ihrem Weg mitnehmen durften. Nach dem Novemberpogrom 1938 bis zum Kriegsbeginn im Westen am 10. Mai 1940 suchten tausende Menschen aus dem ganzen Reich und Österreich den Weg über die Grenzen nach Belgien und den Niederlanden. Sie erfuhren teils uneigennützige Hilfe von ortskundigen Grenzländern, teils wurden sie von Schmugglern, die nun den Menschenschmuggel als lukratives Geschäft entdeckt hatten, über oder bis an die Grenze gebracht. Im Wald an der grünen Grenze spielten sich zahlreiche menschliche Tragödien ab. Die Flüchtenden wurden von deutschen Grenzbeamten und SS-Kontrollen aufgestöbert. Sie wurden ausgeraubt und dann mittellos entweder nach Belgien geschickt oder verhaftet zur Rückkehr ins Reich gezwungen. Willkür und aktueller politischer Druck des Auslands waren jeweils die ausschlaggebenden Motive, in welche Richtung die Flüchtlinge verbracht wurden. Wer nach Belgien geschickt wurde, war noch nicht im anderen Land angekommen. Denn auch auf belgischer Seite wurde streng kontrolliert. Die Diskussion in der Öffentlichkeit und die politische Bewertung in Belgien und den Niederlanden schwankte zwischen hoher Solidarität mit den Verfolgten, Opportunität und Zustimmung für die nationalsozialistischen Ziele. Damit war für viele Flüchtlinge der erste Kontakt mit belgischen Grenzgendarmen und mit der Bevölkerung ein Vabanquespiel. Offiziell hatte Belgien eine 15 km breite Sperrzone eingerichtet, hinter der angelangt sollte kein Flüchtlinge mehr nach Deutschland ausgewiesen werden. Je nach persönlicher Haltung der Gendarmen und der Bevölkerung unterstützten sie die Menschen, über diese Zone hinaus Richtung Brüssel zu gelangen, oder sie wiesen den Weg wieder Richtung Osten zurück an die grüne Grenze.
Zahlreiche zeitgenössische Berichte in der Eupener Tageszeitung „Das Grenzecho“ geben Zeugnis ab von den teils grausamen Geschehen an der Grenze. Nach 1940 verlagerte sich die Grenze nach Westen. Der Flüchtlingsstrom nimmt ab. Nun suchen vermehrt Kriegsgefangene und Deserteure den Weg durch den Grenzwald.
Auswahl einiger Zeitungsartikel
30. November 1938, Mittwoch
"Eupen. Vorgestern nachmittag nahm die Gendarmerie in Gemmenich einen 43-jährigen deutschen Juden namens Z. aus Köln fest, der heimlich die deutsch-belgische Grenze überschritten hatte. Er wurde zwar an die Grenze zurückgeführt, aber wenige Stunden später erneut auf belgischem Gebiet ergriffen. Da er abermals ausgewiesen werden sollte, gab er an, daß er vor einiger Zeit in Brüssel einen Gelddiebstahl ausgeführt habe. Da seine Angaben darüber mit dem amtlichen Bericht übereinstimmten, wurde Z. dem Gericht in Verviers vorgeführt. Es besteht der nicht ganz zurückzuweisende Verdacht, daß Z. diese Selbstbeschuldigung nur vorgebracht hat, um vorläufig einmal in Belgien bleiben zu können. In Raeren trafen Gendarmen fünf Israeliten an, die vollkommen mittellos waren und deutscherseits einfach über die Grenze abgeschoben worden waren. Sie wurden wieder nach Deutschland zurückgeführt. Auch von anderen Stellen wird bestätigt, daß die deutschen Grenzbeamten mittellose Israeliten ohne weitere Umstände zur Grenze führen, wo sie selber sehen müssen, wie sie weiterkommen. So erklärt es sich auch, daß dieselben Personen öfters zwei- oder dreimal von den belgischen Gendarmen aufgegriffen werden, da sie immer abwechselnd hin und her geschoben werden."
2. Dezember 1938, Im Eupener Land
Eupen. Von der Grenze laufen Meldungen über Mitleid erregende Szenen ein, die sich bei der Zurückweisung der mittellosen jüdischen Flüchtlinge aus Deutschland durch die hiesige Gendarmerie abspielen, die dabei der an sie ergangenen Weisung gehorcht. In der Nähe des Bahnhofs von Raeren fand eine Gendarmeriestreife einen 27jährigen jüdischen Flüchtling namens K. aus Berlin, der in völlig erschöpftem Zustande mit eiternden Kopfwunden bedeckt im Straßengraben lag und vorläufig bis zu seiner Besserung in das Sankt-Nikolaus-Hospital verbracht wurde. Die Wunden des K. waren nur nachlässig vernäht. Vor einigen Tagen hatte er einen Selbstmordversuch gemacht durch öffnen der Pulsadern, der aber mißlang. Die Nachricht einiger Blätter, daß K. früher Redakteur am Völkischen Beobachter in Berlin gewesen sei, ist natürlich unzutreffend. Andererseits trifft man immer wieder Fälle wahrer Menschlichkeit an. Wie uns heute morgen bekannt wurde, hat ein hiesiger Einwohner, der angeblich sogar Mitglied der heimattreuen Front ist, sich nach Deutschland begeben, um dort ein vierjähriges Kind mit sich zu nehmen und über Eupen weiter nach Brüssel zu Verwandten zu bringen, die sich dort des verlassenen Kindes annehmen, dessen Vater und Großvater sich in einem deutschen Konzentrationslager befinden. So ungern es der betreffende Einwohner hier vielleicht vermerken wird, daß seine edelmütige Handlungsweise seinen hiesigen Freunden von der heimattreuen Front bekannt wird, so können wir doch nicht umhin, seiner Menschlichkeit ein schönes Zeugnis auszustellen, die natürlich zu den politischen Grundsätzen der heimatreuen Front in krassem Widerspruch steht.
2. Dezember 1938
"Eupen. Wegen versuchten Devisenschmuggels aus Deutschland heraus wurde vorige Woche der hiesige Garageist in Aachen von der Polizei festgenommen. Sein Auto soll ebenfalls beschlagnahmt worden sein. Wie weiter verlautet, habe sich M. auch des unerlaubten Herausbringens von jüdischen Flüchtlingen aus Deutschland heraus schuldig gemacht. Der Verhaftete galt bei allen seinen Freunden als strammer Anhänger des Nationalsozialismus. Seine Freundschaft mit deutschen Zollwächtern an der Grenze ging sogar soweit, daß er sich zuweilen mit diesen scherzhaft herumbalgte. Trotzdem hat hier die allgemeine Einstellung der deutschen Zöllner am Schlagbaum bei Köpfchen wieder einmal Recht behalten, von denen einer kürzlich zu einem hiesigen altbelgischen Herrn, der beruflich häufig die Grenze überschreiten muß, geäußert hat: "Sie, mein Herr, sind Altbelgier, ich kenne Sie seit langem und weiß, daß Sie keine unerlaubten Dinge bei sich führen, trotzdem Sie mich mit 'Gutem Tag' begrüßen und nicht mit 'Heil Hitler'. Wir wissen aber sehr gut, daß es sehr angeraten ist, diejenigen Eupener, die so recht augenfällig und eifrig die Hand zum Gruße heben, von Zeit zu Zeit einmal in näheren Augenschein zu nehmen. Wir haben die Erfahrung gemacht, daß gerade bei diesen, die laut mit 'Heil Hitler' grüßen, oft sehr überraschende Sachen zum Vorschein kommen, die sich sehr wenig mit der so offenkundig zur Schau getragenen Gesinnung vertragen.""
7. Dezember 1938
"Zwei jungen jüdischen Frauen von 21 und 22 Jahren, die aus Wien vertrieben wurden und nach Aachen gekommen waren, gelang es, sich zu Fuß durch die Grenzwachen durchzuschleichen und bis Verviers zu kommen. Sie wollten ihren Männern nachreisen, die sich seit einiger Zeit in Brüssel befinden. Eine der Frauen hat ihr kleines Kind bei sich. In Verviers wandten sie sich zunächst an das Mädchenheim, wo man ihnen den Rat erteilte, sich bei der Polizei zu melden. Dort wurden die Flüchtlinge einem Verhör unterzogen, da sie keine Pässe bei sich hatten und dann über Nacht beherbergt und beköstigt. Die Frauen hatten etwas Geld bei sich, außerdem war für sie bei einem in Verviers ansässigen Bekannten ein Scheck eingetroffen. Da sie über genügend eigene Mittel verfügten, wurden sie an den Bahnhof geleitet, wo sie den Zug nach Brüssel bestiegen, um dort von ihren Männern in Empfang genommen zu werden."
25. Januar 1939
"Eupen. Die Gendarmerie entdeckte bei Eynatten abermals sechs deutsche Juden, drei Männer und drei Frauen, die heimlich die Grenze überschritten hatten. Da die armen Leute keine vorschriftsmäßigen Papiere besaßen, mußten sie an die deutsche Grenze zurückgebracht werden."
31. März 1939
"Eupen. Etwa 50 Meter von der deutschen Grenze entfernt fand man die Leiche einer 1885 geborenen Berlinerin, die heimlich die Grenze überschritten hatte, und dann einem durch Anstrengung und Aufregung verursachten Herzschlage erlegen war."
1. Mai 1939
"Raeren. In der Nacht von Freitag auf Sonntag wurde eine Gruppe von acht jüdischen Flüchtlingen aus Deutschland an der Grenze festgestellt. Fünf unter ihnen gelang es, im Walde zu entkommen, während die übrigen wieder an die Grenze zurückgeleitet wurden."
Ergänzende Literatur:
Arntz, Hans-Dieter: Judenverfolgung und Fluchthilfe im deutsch-belgischen Grenzgebiet. Kreisgebiet Schleiden, Euskirchen, Monschau, Aachen und Eupen/Malmedy,
Euskirchen 1990.
Bremen, Christian: Retter und Gerettete. Solidarität mit jüdischen Menschen im westlichen Rheinland, in Belgien und den Niederlanden während der NS-Zeit, Aachen 2020.
Kirschgens, Stefan: Wege durch das Niemandsland. Dokumentation und Analyse der Hilfe für Flüchtlinge im deutsch-belgisch-niederländischen Grenzland in den Jahren 1933 bis 1945, Köln 1998.
van Rens, Hermann: Flüchtlinge aus Deutschland in der Grenzregion Limburg, in: Wege gegen das Vergessen. Zeitschrift der NS-Dokumentationsstätte, Ausgabe 1, Aachen
2023, S. 34 - 41.

Flucht und Fluchthilfe im Dreiländereck
Die Verfolgung politisch Andersdenkender und jüdischer Staatsbürger sowie aus ethnisch oder sozialen Gründen Verfolgter führte zu zahlreichen Flucht und Schmuggelaktivitäten an den Grenzen des Deutschen Reichs. Aachen als Grenzstadt und damit verbunden die grüne Grenze nach Belgien und den Niederlanden rückten in den Fokus für viele Menschen, die Deutschland nach 1933 verlassen mussten. Auch diente das nahe belgische und niederländische Ausland den Sozialdemokraten, Kommunisten und Gewerkschaftlern gerade in den Jahren bis 1940 als Basis für ihre Untergrundarbeit gegen das Regime im Inland.
Im Vergleich zu heute wurden damals die Grenzen wesentlich massiver kontrolliert. Kein Durchlass war ohne gültige Reisepapiere möglich. Scharfe Zollgesetze regelten den Devisen- und Warenverkehr. Die Grenzen trennten die Menschen und Kulturen. Warenschmuggel und illegaler Grenzverkehr waren seit vielen Jahren in Aachen ein bekanntes Phänomen. Die Untergrundorganisationen der verfolgten politischen Gruppierungen, Parteien und Gewerkschaften schmuggelten unmittelbar nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten Informationsmaterial (bspw. die im Ausland gedruckte Parteizeitung der SPD („Vorwärts“) nach Deutschland. Sie brachten mit ortskundigen Genossen verfolgte Genossen ins zunächst sichere Ausland. Die Flucht der politisch Verfolgten fand insbesondere in den Jahren 1933 – 1935 statt und wurde von der breiten Bevölkerung noch wenig bemerkt.
Je mehr sich die Terrorherrschaft etablierte und je deutlicher die Repressalien gegen die verfolgten Bevölkerungsgruppen wurden, desto schwieriger wurde der Schmuggel. Der Andrang insbesondere jüdischer Menschen, die Deutschland via Aachen Richtung Westen zu verlassen suchten, wuchs stetig. Ziel waren die jüdischen Zentren Belgiens und der Niederlande, Brüssel, Antwerpen und Amsterdam. Die Grenzkontrollen wurden verschärft, um insbesondere den illegalen „Abfluss“ von Devisen und mitgenommenen Wertsachen zu verhindern. Die Rassengesetze von 1935 legten fest, dass Juden, die noch mit legalen Papieren Deutschland verlassen wollten, maximal 10 RM auf ihrem Weg mitnehmen durften. Nach dem Novemberpogrom 1938 bis zum Kriegsbeginn im Westen am 10. Mai 1940 suchten tausende Menschen aus dem ganzen Reich und Österreich den Weg über die Grenzen nach Belgien und den Niederlanden. Sie erfuhren teils uneigennützige Hilfe von ortskundigen Grenzländern, teils wurden sie von Schmugglern, die nun den Menschenschmuggel als lukratives Geschäft entdeckt hatten, über oder bis an die Grenze gebracht. Im Wald an der grünen Grenze spielten sich zahlreiche menschliche Tragödien ab. Die Flüchtenden wurden von deutschen Grenzbeamten und SS-Kontrollen aufgestöbert. Sie wurden ausgeraubt und dann mittellos entweder nach Belgien geschickt oder verhaftet zur Rückkehr ins Reich gezwungen. Willkür und aktueller politischer Druck des Auslands waren jeweils die ausschlaggebenden Motive, in welche Richtung die Flüchtlinge verbracht wurden. Wer nach Belgien geschickt wurde, war noch nicht im anderen Land angekommen. Denn auch auf belgischer Seite wurde streng kontrolliert. Die Diskussion in der Öffentlichkeit und die politische Bewertung in Belgien und den Niederlanden schwankte zwischen hoher Solidarität mit den Verfolgten, Opportunität und Zustimmung für die nationalsozialistischen Ziele. Damit war für viele Flüchtlinge der erste Kontakt mit belgischen Grenzgendarmen und mit der Bevölkerung ein Vabanquespiel. Offiziell hatte Belgien eine 15 km breite Sperrzone eingerichtet, hinter der angelangt sollte kein Flüchtlinge mehr nach Deutschland ausgewiesen werden. Je nach persönlicher Haltung der Gendarmen und der Bevölkerung unterstützten sie die Menschen, über diese Zone hinaus Richtung Brüssel zu gelangen, oder sie wiesen den Weg wieder Richtung Osten zurück an die grüne Grenze.
Zahlreiche zeitgenössische Berichte in der Eupener Tageszeitung „Das Grenzecho“ geben Zeugnis ab von den teils grausamen Geschehen an der Grenze. Nach 1940 verlagerte sich die Grenze nach Westen. Der Flüchtlingsstrom nimmt ab. Nun suchen vermehrt Kriegsgefangene und Deserteure den Weg durch den Grenzwald.
Auswahl einiger Zeitungsartikel
30. November 1938, Mittwoch
"Eupen. Vorgestern nachmittag nahm die Gendarmerie in Gemmenich einen 43-jährigen deutschen Juden namens Z. aus Köln fest, der heimlich die deutsch-belgische Grenze überschritten hatte. Er wurde zwar an die Grenze zurückgeführt, aber wenige Stunden später erneut auf belgischem Gebiet ergriffen. Da er abermals ausgewiesen werden sollte, gab er an, daß er vor einiger Zeit in Brüssel einen Gelddiebstahl ausgeführt habe. Da seine Angaben darüber mit dem amtlichen Bericht übereinstimmten, wurde Z. dem Gericht in Verviers vorgeführt. Es besteht der nicht ganz zurückzuweisende Verdacht, daß Z. diese Selbstbeschuldigung nur vorgebracht hat, um vorläufig einmal in Belgien bleiben zu können. In Raeren trafen Gendarmen fünf Israeliten an, die vollkommen mittellos waren und deutscherseits einfach über die Grenze abgeschoben worden waren. Sie wurden wieder nach Deutschland zurückgeführt. Auch von anderen Stellen wird bestätigt, daß die deutschen Grenzbeamten mittellose Israeliten ohne weitere Umstände zur Grenze führen, wo sie selber sehen müssen, wie sie weiterkommen. So erklärt es sich auch, daß dieselben Personen öfters zwei- oder dreimal von den belgischen Gendarmen aufgegriffen werden, da sie immer abwechselnd hin und her geschoben werden."
2. Dezember 1938, Im Eupener Land
Eupen. Von der Grenze laufen Meldungen über Mitleid erregende Szenen ein, die sich bei der Zurückweisung der mittellosen jüdischen Flüchtlinge aus Deutschland durch die hiesige Gendarmerie abspielen, die dabei der an sie ergangenen Weisung gehorcht. In der Nähe des Bahnhofs von Raeren fand eine Gendarmeriestreife einen 27jährigen jüdischen Flüchtling namens K. aus Berlin, der in völlig erschöpftem Zustande mit eiternden Kopfwunden bedeckt im Straßengraben lag und vorläufig bis zu seiner Besserung in das Sankt-Nikolaus-Hospital verbracht wurde. Die Wunden des K. waren nur nachlässig vernäht. Vor einigen Tagen hatte er einen Selbstmordversuch gemacht durch öffnen der Pulsadern, der aber mißlang. Die Nachricht einiger Blätter, daß K. früher Redakteur am Völkischen Beobachter in Berlin gewesen sei, ist natürlich unzutreffend. Andererseits trifft man immer wieder Fälle wahrer Menschlichkeit an. Wie uns heute morgen bekannt wurde, hat ein hiesiger Einwohner, der angeblich sogar Mitglied der heimattreuen Front ist, sich nach Deutschland begeben, um dort ein vierjähriges Kind mit sich zu nehmen und über Eupen weiter nach Brüssel zu Verwandten zu bringen, die sich dort des verlassenen Kindes annehmen, dessen Vater und Großvater sich in einem deutschen Konzentrationslager befinden. So ungern es der betreffende Einwohner hier vielleicht vermerken wird, daß seine edelmütige Handlungsweise seinen hiesigen Freunden von der heimattreuen Front bekannt wird, so können wir doch nicht umhin, seiner Menschlichkeit ein schönes Zeugnis auszustellen, die natürlich zu den politischen Grundsätzen der heimatreuen Front in krassem Widerspruch steht.
2. Dezember 1938
"Eupen. Wegen versuchten Devisenschmuggels aus Deutschland heraus wurde vorige Woche der hiesige Garageist in Aachen von der Polizei festgenommen. Sein Auto soll ebenfalls beschlagnahmt worden sein. Wie weiter verlautet, habe sich M. auch des unerlaubten Herausbringens von jüdischen Flüchtlingen aus Deutschland heraus schuldig gemacht. Der Verhaftete galt bei allen seinen Freunden als strammer Anhänger des Nationalsozialismus. Seine Freundschaft mit deutschen Zollwächtern an der Grenze ging sogar soweit, daß er sich zuweilen mit diesen scherzhaft herumbalgte. Trotzdem hat hier die allgemeine Einstellung der deutschen Zöllner am Schlagbaum bei Köpfchen wieder einmal Recht behalten, von denen einer kürzlich zu einem hiesigen altbelgischen Herrn, der beruflich häufig die Grenze überschreiten muß, geäußert hat: "Sie, mein Herr, sind Altbelgier, ich kenne Sie seit langem und weiß, daß Sie keine unerlaubten Dinge bei sich führen, trotzdem Sie mich mit 'Gutem Tag' begrüßen und nicht mit 'Heil Hitler'. Wir wissen aber sehr gut, daß es sehr angeraten ist, diejenigen Eupener, die so recht augenfällig und eifrig die Hand zum Gruße heben, von Zeit zu Zeit einmal in näheren Augenschein zu nehmen. Wir haben die Erfahrung gemacht, daß gerade bei diesen, die laut mit 'Heil Hitler' grüßen, oft sehr überraschende Sachen zum Vorschein kommen, die sich sehr wenig mit der so offenkundig zur Schau getragenen Gesinnung vertragen.""
7. Dezember 1938
"Zwei jungen jüdischen Frauen von 21 und 22 Jahren, die aus Wien vertrieben wurden und nach Aachen gekommen waren, gelang es, sich zu Fuß durch die Grenzwachen durchzuschleichen und bis Verviers zu kommen. Sie wollten ihren Männern nachreisen, die sich seit einiger Zeit in Brüssel befinden. Eine der Frauen hat ihr kleines Kind bei sich. In Verviers wandten sie sich zunächst an das Mädchenheim, wo man ihnen den Rat erteilte, sich bei der Polizei zu melden. Dort wurden die Flüchtlinge einem Verhör unterzogen, da sie keine Pässe bei sich hatten und dann über Nacht beherbergt und beköstigt. Die Frauen hatten etwas Geld bei sich, außerdem war für sie bei einem in Verviers ansässigen Bekannten ein Scheck eingetroffen. Da sie über genügend eigene Mittel verfügten, wurden sie an den Bahnhof geleitet, wo sie den Zug nach Brüssel bestiegen, um dort von ihren Männern in Empfang genommen zu werden."
25. Januar 1939
"Eupen. Die Gendarmerie entdeckte bei Eynatten abermals sechs deutsche Juden, drei Männer und drei Frauen, die heimlich die Grenze überschritten hatten. Da die armen Leute keine vorschriftsmäßigen Papiere besaßen, mußten sie an die deutsche Grenze zurückgebracht werden."
31. März 1939
"Eupen. Etwa 50 Meter von der deutschen Grenze entfernt fand man die Leiche einer 1885 geborenen Berlinerin, die heimlich die Grenze überschritten hatte, und dann einem durch Anstrengung und Aufregung verursachten Herzschlage erlegen war."
1. Mai 1939
"Raeren. In der Nacht von Freitag auf Sonntag wurde eine Gruppe von acht jüdischen Flüchtlingen aus Deutschland an der Grenze festgestellt. Fünf unter ihnen gelang es, im Walde zu entkommen, während die übrigen wieder an die Grenze zurückgeleitet wurden."
Dazu ein Artikel vom 22. November 1938:
"Nach umfangreichen Bemühungen gelang es Beamten der deutschen Zollaufsichtstellen Lichtenbusch, Oberforstbach und Aachen-Süd, einen Menschenschmuggler in dem Augenblick festzunehmen, als er Juden nachts über die Grenze nach Belgien zu führen versuchte. Auch konnten nach Absuchen des Geländes fünf Juden im Straßengraben versteckt gefunden und festgenommen werden.
Zwei weiteren Juden gelang es, über die nahe Grenze zu entkommen. Nach weiterem langwierigem Absuchen des Geländes in der Dunkelheit und bei dem starken Nebel wurde ein Gepäckschein gefunden, der von einem Juden weggeworfen worden war. Auf Grund dieses Gepäckscheines konnte im hiesigen Hauptbahnhof ein einem Juden gehöriger Koffer beschlagnahmt werden, der rund 1200 RM enthielt, die ins Ausland verschoben werden sollten. Koffer und Geld verfielen der Beschlagnahme."
Ergänzende Literatur:
Arntz, Hans-Dieter: Judenverfolgung und Fluchthilfe im deutsch-belgischen Grenzgebiet. Kreisgebiet Schleiden, Euskirchen, Monschau, Aachen und Eupen/Malmedy,
Euskirchen 1990.
Bremen, Christian: Retter und Gerettete. Solidarität mit jüdischen Menschen im westlichen Rheinland, in Belgien und den Niederlanden während der NS-Zeit, Aachen 2020.
Kirschgens, Stefan: Wege durch das Niemandsland. Dokumentation und Analyse der Hilfe für Flüchtlinge im deutsch-belgisch-niederländischen Grenzland in den Jahren 1933 bis 1945, Köln 1998.
van Rens, Hermann: Flüchtlinge aus Deutschland in der Grenzregion Limburg, in: Wege gegen das Vergessen. Zeitschrift der NS-Dokumentationsstätte, Ausgabe 1, Aachen
2023, S. 34 - 41.
Flucht und Fluchthilfe im Dreiländereck
Die Verfolgung politisch Andersdenkender und jüdischer Staatsbürger sowie aus ethnisch oder sozialen Gründen Verfolgter führte zu zahlreichen Flucht und Schmuggelaktivitäten an den Grenzen des Deutschen Reichs. Aachen als Grenzstadt und damit verbunden die grüne Grenze nach Belgien und den Niederlanden rückten in den Fokus für viele Menschen, die Deutschland nach 1933 verlassen mussten. Auch diente das nahe belgische und niederländische Ausland den Sozialdemokraten, Kommunisten und Gewerkschaftlern gerade in den Jahren bis 1940 als Basis für ihre Untergrundarbeit gegen das Regime im Inland.
Im Vergleich zu heute wurden damals die Grenzen wesentlich massiver kontrolliert. Kein Durchlass war ohne gültige Reisepapiere möglich. Scharfe Zollgesetze regelten den Devisen- und Warenverkehr. Die Grenzen trennten die Menschen und Kulturen. Warenschmuggel und illegaler Grenzverkehr waren seit vielen Jahren in Aachen ein bekanntes Phänomen. Die Untergrundorganisationen der verfolgten politischen Gruppierungen, Parteien und Gewerkschaften schmuggelten unmittelbar nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten Informationsmaterial (bspw. die im Ausland gedruckte Parteizeitung der SPD („Vorwärts“) nach Deutschland. Sie brachten mit ortskundigen Genossen verfolgte Genossen ins zunächst sichere Ausland. Die Flucht der politisch Verfolgten fand insbesondere in den Jahren 1933 – 1935 statt und wurde von der breiten Bevölkerung noch wenig bemerkt.
Je mehr sich die Terrorherrschaft etablierte und je deutlicher die Repressalien gegen die verfolgten Bevölkerungsgruppen wurden, desto schwieriger wurde der Schmuggel. Der Andrang insbesondere jüdischer Menschen, die Deutschland via Aachen Richtung Westen zu verlassen suchten, wuchs stetig. Ziel waren die jüdischen Zentren Belgiens und der Niederlande, Brüssel, Antwerpen und Amsterdam. Die Grenzkontrollen wurden verschärft, um insbesondere den illegalen „Abfluss“ von Devisen und mitgenommenen Wertsachen zu verhindern. Die Rassengesetze von 1935 legten fest, dass Juden, die noch mit legalen Papieren Deutschland verlassen wollten, maximal 10 RM auf ihrem Weg mitnehmen durften. Nach dem Novemberpogrom 1938 bis zum Kriegsbeginn im Westen am 10. Mai 1940 suchten tausende Menschen aus dem ganzen Reich und Österreich den Weg über die Grenzen nach Belgien und den Niederlanden. Sie erfuhren teils uneigennützige Hilfe von ortskundigen Grenzländern, teils wurden sie von Schmugglern, die nun den Menschenschmuggel als lukratives Geschäft entdeckt hatten, über oder bis an die Grenze gebracht. Im Wald an der grünen Grenze spielten sich zahlreiche menschliche Tragödien ab. Die Flüchtenden wurden von deutschen Grenzbeamten und SS-Kontrollen aufgestöbert. Sie wurden ausgeraubt und dann mittellos entweder nach Belgien geschickt oder verhaftet zur Rückkehr ins Reich gezwungen. Willkür und aktueller politischer Druck des Auslands waren jeweils die ausschlaggebenden Motive, in welche Richtung die Flüchtlinge verbracht wurden. Wer nach Belgien geschickt wurde, war noch nicht im anderen Land angekommen. Denn auch auf belgischer Seite wurde streng kontrolliert. Die Diskussion in der Öffentlichkeit und die politische Bewertung in Belgien und den Niederlanden schwankte zwischen hoher Solidarität mit den Verfolgten, Opportunität und Zustimmung für die nationalsozialistischen Ziele. Damit war für viele Flüchtlinge der erste Kontakt mit belgischen Grenzgendarmen und mit der Bevölkerung ein Vabanquespiel. Offiziell hatte Belgien eine 15 km breite Sperrzone eingerichtet, hinter der angelangt sollte kein Flüchtlinge mehr nach Deutschland ausgewiesen werden. Je nach persönlicher Haltung der Gendarmen und der Bevölkerung unterstützten sie die Menschen, über diese Zone hinaus Richtung Brüssel zu gelangen, oder sie wiesen den Weg wieder Richtung Osten zurück an die grüne Grenze.
Zahlreiche zeitgenössische Berichte in der Eupener Tageszeitung „Das Grenzecho“ geben Zeugnis ab von den teils grausamen Geschehen an der Grenze. Nach 1940 verlagerte sich die Grenze nach Westen. Der Flüchtlingsstrom nimmt ab. Nun suchen vermehrt Kriegsgefangene und Deserteure den Weg durch den Grenzwald.
Ergänzende Literatur:
Arntz, Hans-Dieter: Judenverfolgung und Fluchthilfe im deutsch-belgischen Grenzgebiet. Kreisgebiet Schleiden, Euskirchen, Monschau, Aachen und Eupen/Malmedy,
Euskirchen 1990.
Bremen, Christian: Retter und Gerettete. Solidarität mit jüdischen Menschen im westlichen Rheinland, in Belgien und den Niederlanden während der NS-Zeit, Aachen 2020.
Kirschgens, Stefan: Wege durch das Niemandsland. Dokumentation und Analyse der Hilfe für Flüchtlinge im deutsch-belgisch-niederländischen Grenzland in den Jahren 1933 bis 1945, Köln 1998.
van Rens, Hermann: Flüchtlinge aus Deutschland in der Grenzregion Limburg, in: Wege gegen das Vergessen. Zeitschrift der NS-Dokumentationsstätte, Ausgabe 1, Aachen
2023, S. 34 - 41.
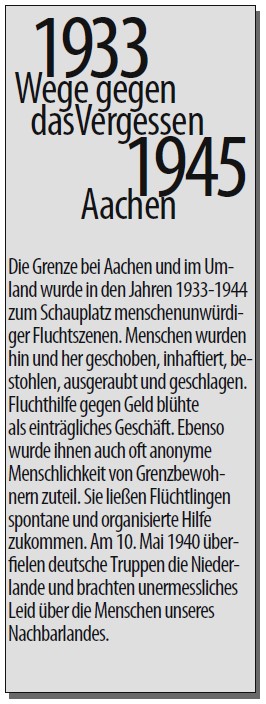
Flucht und Fluchthilfe im Dreiländereck
Die Verfolgung politisch Andersdenkender und jüdischer Staatsbürger sowie aus ethnisch oder sozialen Gründen Verfolgter führte zu zahlreichen Flucht und Schmuggelaktivitäten an den Grenzen des Deutschen Reichs. Aachen als Grenzstadt und damit verbunden die grüne Grenze nach Belgien und den Niederlanden rückten in den Fokus für viele Menschen, die Deutschland nach 1933 verlassen mussten. Auch diente das nahe belgische und niederländische Ausland den Sozialdemokraten, Kommunisten und Gewerkschaftlern gerade in den Jahren bis 1940 als Basis für ihre Untergrundarbeit gegen das Regime im Inland.
Im Vergleich zu heute wurden damals die Grenzen wesentlich massiver kontrolliert. Kein Durchlass war ohne gültige Reisepapiere möglich. Scharfe Zollgesetze regelten den Devisen- und Warenverkehr. Die Grenzen trennten die Menschen und Kulturen. Warenschmuggel und illegaler Grenzverkehr waren seit vielen Jahren in Aachen ein bekanntes Phänomen. Die Untergrundorganisationen der verfolgten politischen Gruppierungen, Parteien und Gewerkschaften schmuggelten unmittelbar nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten Informationsmaterial (bspw. die im Ausland gedruckte Parteizeitung der SPD („Vorwärts“) nach Deutschland. Sie brachten mit ortskundigen Genossen verfolgte Genossen ins zunächst sichere Ausland. Die Flucht der politisch Verfolgten fand insbesondere in den Jahren 1933 – 1935 statt und wurde von der breiten Bevölkerung noch wenig bemerkt.
Je mehr sich die Terrorherrschaft etablierte und je deutlicher die Repressalien gegen die verfolgten Bevölkerungsgruppen wurden, desto schwieriger wurde der Schmuggel. Der Andrang insbesondere jüdischer Menschen, die Deutschland via Aachen Richtung Westen zu verlassen suchten, wuchs stetig. Ziel waren die jüdischen Zentren Belgiens und der Niederlande, Brüssel, Antwerpen und Amsterdam. Die Grenzkontrollen wurden verschärft, um insbesondere den illegalen „Abfluss“ von Devisen und mitgenommenen Wertsachen zu verhindern. Die Rassengesetze von 1935 legten fest, dass Juden, die noch mit legalen Papieren Deutschland verlassen wollten, maximal 10 RM auf ihrem Weg mitnehmen durften. Nach dem Novemberpogrom 1938 bis zum Kriegsbeginn im Westen am 10. Mai 1940 suchten tausende Menschen aus dem ganzen Reich und Österreich den Weg über die Grenzen nach Belgien und den Niederlanden. Sie erfuhren teils uneigennützige Hilfe von ortskundigen Grenzländern, teils wurden sie von Schmugglern, die nun den Menschenschmuggel als lukratives Geschäft entdeckt hatten, über oder bis an die Grenze gebracht. Im Wald an der grünen Grenze spielten sich zahlreiche menschliche Tragödien ab. Die Flüchtenden wurden von deutschen Grenzbeamten und SS-Kontrollen aufgestöbert. Sie wurden ausgeraubt und dann mittellos entweder nach Belgien geschickt oder verhaftet zur Rückkehr ins Reich gezwungen. Willkür und aktueller politischer Druck des Auslands waren jeweils die ausschlaggebenden Motive, in welche Richtung die Flüchtlinge verbracht wurden. Wer nach Belgien geschickt wurde, war noch nicht im anderen Land angekommen. Denn auch auf belgischer Seite wurde streng kontrolliert. Die Diskussion in der Öffentlichkeit und die politische Bewertung in Belgien und den Niederlanden schwankte zwischen hoher Solidarität mit den Verfolgten, Opportunität und Zustimmung für die nationalsozialistischen Ziele. Damit war für viele Flüchtlinge der erste Kontakt mit belgischen Grenzgendarmen und mit der Bevölkerung ein Vabanquespiel. Offiziell hatte Belgien eine 15 km breite Sperrzone eingerichtet, hinter der angelangt sollte kein Flüchtlinge mehr nach Deutschland ausgewiesen werden. Je nach persönlicher Haltung der Gendarmen und der Bevölkerung unterstützten sie die Menschen, über diese Zone hinaus Richtung Brüssel zu gelangen, oder sie wiesen den Weg wieder Richtung Osten zurück an die grüne Grenze.
Zahlreiche zeitgenössische Berichte in der Eupener Tageszeitung „Das Grenzecho“ geben Zeugnis ab von den teils grausamen Geschehen an der Grenze. Nach 1940 verlagerte sich die Grenze nach Westen. Der Flüchtlingsstrom nimmt ab. Nun suchen vermehrt Kriegsgefangene und Deserteure den Weg durch den Grenzwald.
Auswahl einiger Artikel
30. November 1938, Mittwoch
"Eupen. Vorgestern nachmittag nahm die Gendarmerie in Gemmenich einen 43-jährigen deutschen Juden namens Z. aus Köln fest, der heimlich die deutsch-belgische Grenze überschritten hatte. Er wurde zwar an die Grenze zurückgeführt, aber wenige Stunden später erneut auf belgischem Gebiet ergriffen. Da er abermals ausgewiesen werden sollte, gab er an, daß er vor einiger Zeit in Brüssel einen Gelddiebstahl ausgeführt habe. Da seine Angaben darüber mit dem amtlichen Bericht übereinstimmten, wurde Z. dem Gericht in Verviers vorgeführt. Es besteht der nicht ganz zurückzuweisende Verdacht, daß Z. diese Selbstbeschuldigung nur vorgebracht hat, um vorläufig einmal in Belgien bleiben zu können. In Raeren trafen Gendarmen fünf Israeliten an, die vollkommen mittellos waren und deutscherseits einfach über die Grenze abgeschoben worden waren. Sie wurden wieder nach Deutschland zurückgeführt. Auch von anderen Stellen wird bestätigt, daß die deutschen Grenzbeamten mittellose Israeliten ohne weitere Umstände zur Grenze führen, wo sie selber sehen müssen, wie sie weiterkommen. So erklärt es sich auch, daß dieselben Personen öfters zwei- oder dreimal von den belgischen Gendarmen aufgegriffen werden, da sie immer abwechselnd hin und her geschoben werden."
2. Dezember 1938, Im Eupener Land
Eupen. Von der Grenze laufen Meldungen über Mitleid erregende Szenen ein, die sich bei der Zurückweisung der mittellosen jüdischen Flüchtlinge aus Deutschland durch die hiesige Gendarmerie abspielen, die dabei der an sie ergangenen Weisung gehorcht. In der Nähe des Bahnhofs von Raeren fand eine Gendarmeriestreife einen 27jährigen jüdischen Flüchtling namens K. aus Berlin, der in völlig erschöpftem Zustande mit eiternden Kopfwunden bedeckt im Straßengraben lag und vorläufig bis zu seiner Besserung in das Sankt-Nikolaus-Hospital verbracht wurde. Die Wunden des K. waren nur nachlässig vernäht. Vor einigen Tagen hatte er einen Selbstmordversuch gemacht durch öffnen der Pulsadern, der aber mißlang. Die Nachricht einiger Blätter, daß K. früher Redakteur am Völkischen Beobachter in Berlin gewesen sei, ist natürlich unzutreffend. Andererseits trifft man immer wieder Fälle wahrer Menschlichkeit an. Wie uns heute morgen bekannt wurde, hat ein hiesiger Einwohner, der angeblich sogar Mitglied der heimattreuen Front ist, sich nach Deutschland begeben, um dort ein vierjähriges Kind mit sich zu nehmen und über Eupen weiter nach Brüssel zu Verwandten zu bringen, die sich dort des verlassenen Kindes annehmen, dessen Vater und Großvater sich in einem deutschen Konzentrationslager befinden. So ungern es der betreffende Einwohner hier vielleicht vermerken wird, daß seine edelmütige Handlungsweise seinen hiesigen Freunden von der heimattreuen Front bekannt wird, so können wir doch nicht umhin, seiner Menschlichkeit ein schönes Zeugnis auszustellen, die natürlich zu den politischen Grundsätzen der heimatreuen Front in krassem Widerspruch steht.
2. Dezember 1938
"Eupen. Wegen versuchten Devisenschmuggels aus Deutschland heraus wurde vorige Woche der hiesige Garageist in Aachen von der Polizei festgenommen. Sein Auto soll ebenfalls beschlagnahmt worden sein. Wie weiter verlautet, habe sich M. auch des unerlaubten Herausbringens von jüdischen Flüchtlingen aus Deutschland heraus schuldig gemacht. Der Verhaftete galt bei allen seinen Freunden als strammer Anhänger des Nationalsozialismus. Seine Freundschaft mit deutschen Zollwächtern an der Grenze ging sogar soweit, daß er sich zuweilen mit diesen scherzhaft herumbalgte. Trotzdem hat hier die allgemeine Einstellung der deutschen Zöllner am Schlagbaum bei Köpfchen wieder einmal Recht behalten, von denen einer kürzlich zu einem hiesigen altbelgischen Herrn, der beruflich häufig die Grenze überschreiten muß, geäußert hat: "Sie, mein Herr, sind Altbelgier, ich kenne Sie seit langem und weiß, daß Sie keine unerlaubten Dinge bei sich führen, trotzdem Sie mich mit 'Gutem Tag' begrüßen und nicht mit 'Heil Hitler'. Wir wissen aber sehr gut, daß es sehr angeraten ist, diejenigen Eupener, die so recht augenfällig und eifrig die Hand zum Gruße heben, von Zeit zu Zeit einmal in näheren Augenschein zu nehmen. Wir haben die Erfahrung gemacht, daß gerade bei diesen, die laut mit 'Heil Hitler' grüßen, oft sehr überraschende Sachen zum Vorschein kommen, die sich sehr wenig mit der so offenkundig zur Schau getragenen Gesinnung vertragen.""
7. Dezember 1938
"Zwei jungen jüdischen Frauen von 21 und 22 Jahren, die aus Wien vertrieben wurden und nach Aachen gekommen waren, gelang es, sich zu Fuß durch die Grenzwachen durchzuschleichen und bis Verviers zu kommen. Sie wollten ihren Männern nachreisen, die sich seit einiger Zeit in Brüssel befinden. Eine der Frauen hat ihr kleines Kind bei sich. In Verviers wandten sie sich zunächst an das Mädchenheim, wo man ihnen den Rat erteilte, sich bei der Polizei zu melden. Dort wurden die Flüchtlinge einem Verhör unterzogen, da sie keine Pässe bei sich hatten und dann über Nacht beherbergt und beköstigt. Die Frauen hatten etwas Geld bei sich, außerdem war für sie bei einem in Verviers ansässigen Bekannten ein Scheck eingetroffen. Da sie über genügend eigene Mittel verfügten, wurden sie an den Bahnhof geleitet, wo sie den Zug nach Brüssel bestiegen, um dort von ihren Männern in Empfang genommen zu werden."
25. Januar 1939
"Eupen. Die Gendarmerie entdeckte bei Eynatten abermals sechs deutsche Juden, drei Männer und drei Frauen, die heimlich die Grenze überschritten hatten. Da die armen Leute keine vorschriftsmäßigen Papiere besaßen, mußten sie an die deutsche Grenze zurückgebracht werden."
31. März 1939
"Eupen. Etwa 50 Meter von der deutschen Grenze entfernt fand man die Leiche einer 1885 geborenen Berlinerin, die heimlich die Grenze überschritten hatte, und dann einem durch Anstrengung und Aufregung verursachten Herzschlage erlegen war."
1. Mai 1939
"Raeren. In der Nacht von Freitag auf Sonntag wurde eine Gruppe von acht jüdischen Flüchtlingen aus Deutschland an der Grenze festgestellt. Fünf unter ihnen gelang es, im Walde zu entkommen, während die übrigen wieder an die Grenze zurückgeleitet wurden."
Ergänzende Literatur:
Arntz, Hans-Dieter: Judenverfolgung und Fluchthilfe im deutsch-belgischen Grenzgebiet. Kreisgebiet Schleiden, Euskirchen, Monschau, Aachen und Eupen/Malmedy,
Euskirchen 1990.
Bremen, Christian: Retter und Gerettete. Solidarität mit jüdischen Menschen im westlichen Rheinland, in Belgien und den Niederlanden während der NS-Zeit, Aachen 2020.
Kirschgens, Stefan: Wege durch das Niemandsland. Dokumentation und Analyse der Hilfe für Flüchtlinge im deutsch-belgisch-niederländischen Grenzland in den Jahren 1933 bis 1945, Köln 1998.
van Rens, Hermann: Flüchtlinge aus Deutschland in der Grenzregion Limburg, in: Wege gegen das Vergessen. Zeitschrift der NS-Dokumentationsstätte, Ausgabe 1, Aachen
2023, S. 34 - 41.
Flucht und Fluchthilfe im Dreiländereck
Die Verfolgung politisch Andersdenkender und jüdischer Staatsbürger sowie aus ethnisch oder sozialen Gründen Verfolgter führte zu zahlreichen Flucht und Schmuggelaktivitäten an den Grenzen des Deutschen Reichs. Aachen als Grenzstadt und damit verbunden die grüne Grenze nach Belgien und den Niederlanden rückten in den Fokus für viele Menschen, die Deutschland nach 1933 verlassen mussten. Auch diente das nahe belgische und niederländische Ausland den Sozialdemokraten, Kommunisten und Gewerkschaftlern gerade in den Jahren bis 1940 als Basis für ihre Untergrundarbeit gegen das Regime im Inland.
Im Vergleich zu heute wurden damals die Grenzen wesentlich massiver kontrolliert. Kein Durchlass war ohne gültige Reisepapiere möglich. Scharfe Zollgesetze regelten den Devisen- und Warenverkehr. Die Grenzen trennten die Menschen und Kulturen. Warenschmuggel und illegaler Grenzverkehr waren seit vielen Jahren in Aachen ein bekanntes Phänomen. Die Untergrundorganisationen der verfolgten politischen Gruppierungen, Parteien und Gewerkschaften schmuggelten unmittelbar nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten Informationsmaterial (bspw. die im Ausland gedruckte Parteizeitung der SPD („Vorwärts“) nach Deutschland. Sie brachten mit ortskundigen Genossen verfolgte Genossen ins zunächst sichere Ausland. Die Flucht der politisch Verfolgten fand insbesondere in den Jahren 1933 – 1935 statt und wurde von der breiten Bevölkerung noch wenig bemerkt.
Je mehr sich die Terrorherrschaft etablierte und je deutlicher die Repressalien gegen die verfolgten Bevölkerungsgruppen wurden, desto schwieriger wurde der Schmuggel. Der Andrang insbesondere jüdischer Menschen, die Deutschland via Aachen Richtung Westen zu verlassen suchten, wuchs stetig. Ziel waren die jüdischen Zentren Belgiens und der Niederlande, Brüssel, Antwerpen und Amsterdam. Die Grenzkontrollen wurden verschärft, um insbesondere den illegalen „Abfluss“ von Devisen und mitgenommenen Wertsachen zu verhindern. Die Rassengesetze von 1935 legten fest, dass Juden, die noch mit legalen Papieren Deutschland verlassen wollten, maximal 10 RM auf ihrem Weg mitnehmen durften. Nach dem Novemberpogrom 1938 bis zum Kriegsbeginn im Westen am 10. Mai 1940 suchten tausende Menschen aus dem ganzen Reich und Österreich den Weg über die Grenzen nach Belgien und den Niederlanden. Sie erfuhren teils uneigennützige Hilfe von ortskundigen Grenzländern, teils wurden sie von Schmugglern, die nun den Menschenschmuggel als lukratives Geschäft entdeckt hatten, über oder bis an die Grenze gebracht. Im Wald an der grünen Grenze spielten sich zahlreiche menschliche Tragödien ab. Die Flüchtenden wurden von deutschen Grenzbeamten und SS-Kontrollen aufgestöbert. Sie wurden ausgeraubt und dann mittellos entweder nach Belgien geschickt oder verhaftet zur Rückkehr ins Reich gezwungen. Willkür und aktueller politischer Druck des Auslands waren jeweils die ausschlaggebenden Motive, in welche Richtung die Flüchtlinge verbracht wurden. Wer nach Belgien geschickt wurde, war noch nicht im anderen Land angekommen. Denn auch auf belgischer Seite wurde streng kontrolliert. Die Diskussion in der Öffentlichkeit und die politische Bewertung in Belgien und den Niederlanden schwankte zwischen hoher Solidarität mit den Verfolgten, Opportunität und Zustimmung für die nationalsozialistischen Ziele. Damit war für viele Flüchtlinge der erste Kontakt mit belgischen Grenzgendarmen und mit der Bevölkerung ein Vabanquespiel. Offiziell hatte Belgien eine 15 km breite Sperrzone eingerichtet, hinter der angelangt sollte kein Flüchtlinge mehr nach Deutschland ausgewiesen werden. Je nach persönlicher Haltung der Gendarmen und der Bevölkerung unterstützten sie die Menschen, über diese Zone hinaus Richtung Brüssel zu gelangen, oder sie wiesen den Weg wieder Richtung Osten zurück an die grüne Grenze.
Zahlreiche zeitgenössische Berichte in der Eupener Tageszeitung „Das Grenzecho“ geben Zeugnis ab von den teils grausamen Geschehen an der Grenze. Nach 1940 verlagerte sich die Grenze nach Westen. Der Flüchtlingsstrom nimmt ab. Nun suchen vermehrt Kriegsgefangene und Deserteure den Weg durch den Grenzwald.
Auswahl einiger Zeitungsartikel
30. November 1938, Mittwoch
"Eupen. Vorgestern nachmittag nahm die Gendarmerie in Gemmenich einen 43-jährigen deutschen Juden namens Z. aus Köln fest, der heimlich die deutsch-belgische Grenze überschritten hatte. Er wurde zwar an die Grenze zurückgeführt, aber wenige Stunden später erneut auf belgischem Gebiet ergriffen. Da er abermals ausgewiesen werden sollte, gab er an, daß er vor einiger Zeit in Brüssel einen Gelddiebstahl ausgeführt habe. Da seine Angaben darüber mit dem amtlichen Bericht übereinstimmten, wurde Z. dem Gericht in Verviers vorgeführt. Es besteht der nicht ganz zurückzuweisende Verdacht, daß Z. diese Selbstbeschuldigung nur vorgebracht hat, um vorläufig einmal in Belgien bleiben zu können. In Raeren trafen Gendarmen fünf Israeliten an, die vollkommen mittellos waren und deutscherseits einfach über die Grenze abgeschoben worden waren. Sie wurden wieder nach Deutschland zurückgeführt. Auch von anderen Stellen wird bestätigt, daß die deutschen Grenzbeamten mittellose Israeliten ohne weitere Umstände zur Grenze führen, wo sie selber sehen müssen, wie sie weiterkommen. So erklärt es sich auch, daß dieselben Personen öfters zwei- oder dreimal von den belgischen Gendarmen aufgegriffen werden, da sie immer abwechselnd hin und her geschoben werden."
2. Dezember 1938, Im Eupener Land
Eupen. Von der Grenze laufen Meldungen über Mitleid erregende Szenen ein, die sich bei der Zurückweisung der mittellosen jüdischen Flüchtlinge aus Deutschland durch die hiesige Gendarmerie abspielen, die dabei der an sie ergangenen Weisung gehorcht. In der Nähe des Bahnhofs von Raeren fand eine Gendarmeriestreife einen 27jährigen jüdischen Flüchtling namens K. aus Berlin, der in völlig erschöpftem Zustande mit eiternden Kopfwunden bedeckt im Straßengraben lag und vorläufig bis zu seiner Besserung in das Sankt-Nikolaus-Hospital verbracht wurde. Die Wunden des K. waren nur nachlässig vernäht. Vor einigen Tagen hatte er einen Selbstmordversuch gemacht durch öffnen der Pulsadern, der aber mißlang. Die Nachricht einiger Blätter, daß K. früher Redakteur am Völkischen Beobachter in Berlin gewesen sei, ist natürlich unzutreffend. Andererseits trifft man immer wieder Fälle wahrer Menschlichkeit an. Wie uns heute morgen bekannt wurde, hat ein hiesiger Einwohner, der angeblich sogar Mitglied der heimattreuen Front ist, sich nach Deutschland begeben, um dort ein vierjähriges Kind mit sich zu nehmen und über Eupen weiter nach Brüssel zu Verwandten zu bringen, die sich dort des verlassenen Kindes annehmen, dessen Vater und Großvater sich in einem deutschen Konzentrationslager befinden. So ungern es der betreffende Einwohner hier vielleicht vermerken wird, daß seine edelmütige Handlungsweise seinen hiesigen Freunden von der heimattreuen Front bekannt wird, so können wir doch nicht umhin, seiner Menschlichkeit ein schönes Zeugnis auszustellen, die natürlich zu den politischen Grundsätzen der heimatreuen Front in krassem Widerspruch steht.
2. Dezember 1938
"Eupen. Wegen versuchten Devisenschmuggels aus Deutschland heraus wurde vorige Woche der hiesige Garageist in Aachen von der Polizei festgenommen. Sein Auto soll ebenfalls beschlagnahmt worden sein. Wie weiter verlautet, habe sich M. auch des unerlaubten Herausbringens von jüdischen Flüchtlingen aus Deutschland heraus schuldig gemacht. Der Verhaftete galt bei allen seinen Freunden als strammer Anhänger des Nationalsozialismus. Seine Freundschaft mit deutschen Zollwächtern an der Grenze ging sogar soweit, daß er sich zuweilen mit diesen scherzhaft herumbalgte. Trotzdem hat hier die allgemeine Einstellung der deutschen Zöllner am Schlagbaum bei Köpfchen wieder einmal Recht behalten, von denen einer kürzlich zu einem hiesigen altbelgischen Herrn, der beruflich häufig die Grenze überschreiten muß, geäußert hat: "Sie, mein Herr, sind Altbelgier, ich kenne Sie seit langem und weiß, daß Sie keine unerlaubten Dinge bei sich führen, trotzdem Sie mich mit 'Gutem Tag' begrüßen und nicht mit 'Heil Hitler'. Wir wissen aber sehr gut, daß es sehr angeraten ist, diejenigen Eupener, die so recht augenfällig und eifrig die Hand zum Gruße heben, von Zeit zu Zeit einmal in näheren Augenschein zu nehmen. Wir haben die Erfahrung gemacht, daß gerade bei diesen, die laut mit 'Heil Hitler' grüßen, oft sehr überraschende Sachen zum Vorschein kommen, die sich sehr wenig mit der so offenkundig zur Schau getragenen Gesinnung vertragen.""
7. Dezember 1938
"Zwei jungen jüdischen Frauen von 21 und 22 Jahren, die aus Wien vertrieben wurden und nach Aachen gekommen waren, gelang es, sich zu Fuß durch die Grenzwachen durchzuschleichen und bis Verviers zu kommen. Sie wollten ihren Männern nachreisen, die sich seit einiger Zeit in Brüssel befinden. Eine der Frauen hat ihr kleines Kind bei sich. In Verviers wandten sie sich zunächst an das Mädchenheim, wo man ihnen den Rat erteilte, sich bei der Polizei zu melden. Dort wurden die Flüchtlinge einem Verhör unterzogen, da sie keine Pässe bei sich hatten und dann über Nacht beherbergt und beköstigt. Die Frauen hatten etwas Geld bei sich, außerdem war für sie bei einem in Verviers ansässigen Bekannten ein Scheck eingetroffen. Da sie über genügend eigene Mittel verfügten, wurden sie an den Bahnhof geleitet, wo sie den Zug nach Brüssel bestiegen, um dort von ihren Männern in Empfang genommen zu werden."
25. Januar 1939
"Eupen. Die Gendarmerie entdeckte bei Eynatten abermals sechs deutsche Juden, drei Männer und drei Frauen, die heimlich die Grenze überschritten hatten. Da die armen Leute keine vorschriftsmäßigen Papiere besaßen, mußten sie an die deutsche Grenze zurückgebracht werden."
31. März 1939
"Eupen. Etwa 50 Meter von der deutschen Grenze entfernt fand man die Leiche einer 1885 geborenen Berlinerin, die heimlich die Grenze überschritten hatte, und dann einem durch Anstrengung und Aufregung verursachten Herzschlage erlegen war."
1. Mai 1939
"Raeren. In der Nacht von Freitag auf Sonntag wurde eine Gruppe von acht jüdischen Flüchtlingen aus Deutschland an der Grenze festgestellt. Fünf unter ihnen gelang es, im Walde zu entkommen, während die übrigen wieder an die Grenze zurückgeleitet wurden."
Ergänzende Literatur:
Arntz, Hans-Dieter: Judenverfolgung und Fluchthilfe im deutsch-belgischen Grenzgebiet. Kreisgebiet Schleiden, Euskirchen, Monschau, Aachen und Eupen/Malmedy,
Euskirchen 1990.
Bremen, Christian: Retter und Gerettete. Solidarität mit jüdischen Menschen im westlichen Rheinland, in Belgien und den Niederlanden während der NS-Zeit, Aachen 2020.
Kirschgens, Stefan: Wege durch das Niemandsland. Dokumentation und Analyse der Hilfe für Flüchtlinge im deutsch-belgisch-niederländischen Grenzland in den Jahren 1933 bis 1945, Köln 1998.
van Rens, Hermann: Flüchtlinge aus Deutschland in der Grenzregion Limburg, in: Wege gegen das Vergessen. Zeitschrift der NS-Dokumentationsstätte, Ausgabe 1, Aachen
2023, S. 34 - 41.
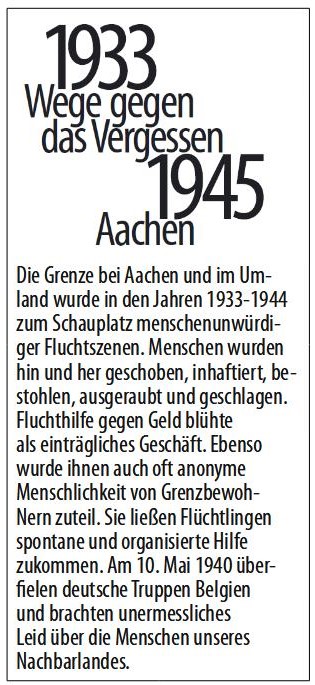
Der jüdische Friedhof in Haaren
Unterhalb der Kuppe des Haarberges liegt, eingezäunt durch Hecke und Zaun, der jüdische Friedhof von Haaren. Er ist über die Alt-Haarener-Str. zu erreichen. Noch vor der Autobahnbrücke biegt man, in Richtung Würselen fahrend, rechts ab. Auf dem Friedhof befinden sich heute noch ein Doppelgrabstein und ein Gedenkstein. Angelegt wurde der Friedhof im Jahre 1839. Bis dahin wurden die Verstorbenen der jüdischen Gemeinde Haaren auf dem jüdischen Friedhof in Aachen an der Lütticher Straße bzw. in Vaals beerdigt.
Im November 1938, einige Tage nach der Reichspogromnacht, warfen Nationalsozialisten sämtliche Grabsteine auf dem Friedhof um. Im Herbst 1939 wurden die herumliegenden Grabsteine der gesamten Friedhofsanlage entfernt und nach Haaren transportiert. Das nunmehr leere Friedhofsgelände wurde während des Krieges durch Kampfhandlungen immer mehr zerstört. 1948 wurde der Friedhof wieder instandgesetzt. Da keine Grabstätten mehr erkennbar waren, wurde das ganze Friedhofsgelände als Ort des Gedenkens neu gestaltet. Bei diesen Aufräumarbeiten fand man einen fast unbeschädigten Grabstein. Er gehörte zu dem ersten Grab, das 1839 für das Ehepaar Menken auf dem neu angelegten Friedhof errichtet wurde. Bis 1997 dienten viele der Grabsteine als Böschungsmauer an der Alt-Haarener-Straße.
Ergänzende Literatur:
Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Aachen e.V. (Hrsg.): Spuren jüdischen Lebens in Aachen von 1850 bis 1938. Eine Anschauungsmappe,
Aachen 1992.
Peters, Dieter: Der jüdische Friedhof in Haaren, in: Volkshochschule Aachen (Hrsg.): Beitrage zur Geschichte des Nationalsozialismus in Aachen, Aachen 2012.
Sturm, Hans: Der jüdische Friedhof in Aachen-Haaren, in: Beyer, Eduard (bearb.): Jüdische Bürger aus Haaren bei Aachen und die Opfer der Brander jüdischen
Bevölkerung, Aachen 1998, S. 15 - 23.

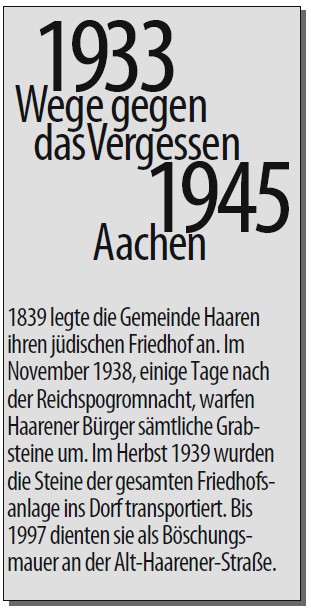
„Judenhaus“
Schon bald nach den Wahlen vom 5. März 1933 wurden mehrere einschneidende, antisemitische Maßnahmen im Kontext der Gleichschaltung von der nationalsozialistischen Regierung gesetzlich verankert und damit rechtlich legitimiert. Die Folge waren alltägliche Diskriminierungen, Boykottmaßnahmen sowie die Entlassung jüdischer Angestellter aus dem öffentlichen Dienst. Eine neue Qualität der staatlichen, antisemitischen Maßnahmen brachten die ”Nürnberger Rassegesetze” vom 15. September 1935. Das ”Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre” verbot beispielsweise Eheschließung und außerehelichen Geschlechtsverkehr zwischen Juden und ”Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes”. Das Reichsbürgergesetz unterschied zwischen ”Reichsbürgern als Trägern der vollen politischen Rechte” (jüdische Menschen waren davon ausgeschlossen) und ”Staatsangehörigen”, wodurch jüdische Menschen zu 'Bürger*innen zweiter Klasse' wurden.
Eine besondere historische Zäsur markierten die Novemberpogrome 1938. Nach der sog. Reichspogromnacht am 09. und 10 November 1938 verschärfte sich das nationalsozialistische Vorgehen und verlagerte sich sukzessive von jener formaljuristischen Ausgrenzung und Diskriminierung hin zu einer exekutiven Verfolgungspolitik.
Auf formaljuristischer Ebene wurde noch in der unmittelbaren zeitlichen Folge auf die Pogrome der wirtschaftliche und existentielle Niedergang der Jüdinnen und Juden gesetzlich festgesetzt. Mit der „Verordnung über den Einsatz des jüdischen Vermögens“ vom 03. Dezember 1938 wurden jüdische Bürger*innen nicht nur gezwungen, ihre Geschäfte und Gewerbebetriebe zu verkaufen, und die im Kontext der Arisierung häufig zu Spottpreisen. Vielmehr hatte diese Verordnung auch die Enteignung von Devisen und Grundbesitz in jüdischer Hand zur Folge.
Durch das Gesetz über die „Mietverhältnisse mit Juden“ vom 30. April 1939 wurde der Mietschutz für jüdische Menschen aufgehoben, wodurch die bereits aus ihren Wohnungen und Häusern vertriebenen Jüdinnen und Juden noch mehr der Willkür der NS-Behörden und der „arischen“ Bürger*innen ausgesetzt wurden. Jüdischen Mieter*innen konnte gekündigt werden, sofern „Ersatzwohnraum“ (Reichsgesetzblatt, Jahrgang 1939, Teil 1, S. 864) nachgewiesen werden konnte. Ferner konnten jüdische Mieter*innen zur Unterbringung von jüdischen Untermietern aufgefordert werden. Somit wurde eine Zusammenlegung jüdischer Menschen im Kontext einer Ghettoisierung bereits von Seiten der NS-Führung intendiert: „[…] Nach Möglichkeit [sei] so zu verfahren, daß Juden in einem Haus zusammengelegt werden, soweit die Mietverhältnisse dies gestatten würden“, so Göring.(1)
Innerhalb der NS-Funktionäre herrschte indes jedoch Uneinigkeit bezüglich der konkreten Umsetzung der Ghettoisierung der jüdischen Bevölkerung im deutschen Reich. Während Göring für eine Errichtung von Ghettos plädierte, stellte sich Reinhard Heydrich, SS-Obergruppenführer und Leiter des Reichssicherheitshauptamtes (RSHA), dagegen, da er Schwierigkeiten bei der polizeilichen Überwachung befürchtete. Er sprach sich für die Errichtung von sog. Judenhäusern auf deutschem Gebiet aus.
Ab Herbst 1939 wurde die Internierung der jüdischen Bevölkerung auf diesem dezentralen Weg umgesetzt. Auf Anweisung der zuständigen Gestapo wurden die Jüdinnen und Juden in Gebäude wie Kindergärten, Schulen oder ehemaligen Fabriken, die notdürftig und häufig unter menschenunwürdigen Umständen zu Wohnzwecken ertüchtigt wurden, eingewiesen.
In Aachen setzte der Rat der Stadt dieses Vorhaben zum 1. April 1941 um, wobei auch hier zunächst wirtschaftliche Erwägungen im Vordergrund standen, da Immobilien und Eigentum jüdischer Besitzer*innen enteignet und dem 'Nutzen der Volksgemeinschaft' zugeführt werden sollte.
Die Stadt Aachen erwarb mehrere Immobilien, die als sog. Judenhäuser eingerichtet wurden. Es handelte sich um folgende Adressen: Königstraße 22, Eupenerstraße 249, Promenadenstraße 21 und Triererstraße 285. Im August 1941 erwarb die Stadt zusätzlich das Gebäude in der Alexanderstraße 95 „zur Unterbringung von Juden“(2). Ferner wurde in der Försterstraße 28 ein Haus zur Internierung von Familien, die im Nazijargon in „privilegierter Mischehe“ lebten, eingerichtet. Auch das Jüdische Altenheim in Kalverbenden wurde in die regionallogistische Struktur der nationalsozialistischen Konzentrationsvorhaben der jüdischen Bevölkerung integriert. Am Grünen Weg 12 wurde ein sog. Judenlager errichtet, in dem hunderte Menschen interniert und von dort aus deportiert wurden.
Das Haus in der Königstraße 22 wurde 1738 als „Haus Königstein“ erbaut und wurde bis zum Beginn des 20. Jahrhundert vor allem für die Tuchindustrie, beispielsweise durch die Tuchfabrik J. H. Kesselkaul, verwendet. Seit 1901 ließ sich die Häutehandlung der Familie Breuer sowie die Leder- und Treibriehmenfabrik von August Schwan nieder.
Auf Grundlage der Deportationslisten, in denen der letzte Wohnort der Deportierten angegeben wurde, sowie der Entschädigungsakten der Betroffenen können 16 bzw. 22 Personen in der Königsstraße 22 verortet werden. Die Diskrepanz ergibt sich aus einem vermutlichen Fehler bei weiteren Mitgliedern der Familie Weinhausen, bei denen die Königstraße 31 als letzter Wohnort angegeben wurde.
Eine der Bewohnerinnen des „Judenhauses“ gibt in ihrer Entschädigungsakte Einblicke in die dortigen Lebensumstände, welche sie selbst als „menschenunwürdig“ beschrieb. Die 10 dort lebenden Familien lebten in kleinen Kammern, die in den großen Räumen der industriell genutzten Immobilie mithilfe von Vorhängen und Hausrat notdürftig eingerichtet wurden. Diese hatten eine geschätzte Größe von 6 bis 7 Quadratmetern, wodurch die Bewohner*innen gezwungen wurden, lediglich mit einem Bett und einem Schrank in den Kammern zu leben. Aufgrund der zurückliegenden Nutzung für die Lederindustrie setzte sich ein „abscheulicher Geruch“ in den Räumen fest. Ratten trieben sich in den Räumen umher. Die polizeiliche Überwachung durch die Gestapo übte darüber hinaus einen enormen psychischen Druck auf die Internierten aus und schränkte deren Handlungskontexte weiter ein.
1942 schließlich wurde das Haus, wie die anderen sog. Judenhäuser auch, in die regionale Logistik der Shoah integriert, so dass die Bewohner*innen von hier aus den Deportationszügen zugeführt wurden. Am 22. März 1942 wurden zwei Bewohner*innen mit dem Transport DA 17, dessen Ziel das Transitlager Izbica war, deportiert, die letzten 13 Bewohner*innen am 25. Juli 1942 nach Majdanek bzw. Sobibor, wobei der Großteil dem präzedenzlosen Verbrechen der Shoah zum Opfer fiel.
Das Haus erlitt in den Kriegsjahren Schäden und brannte aus, wodurch nur die Fassade erhalten blieb.
(1) Heim, Susanne (bearb.): Deutsches Reich 1938 – August 1939, (= Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933–1945, hrsg. Bd. 2), München 2009, S. 583.
(2) Dokument Nr. 1114, in: Lepper, Herbert: Von Der Emanzipation zum Holocaust. Die israelitische Synagogengemeinde zu Aachen 1801-1942, Aachen 1994.
Ergänzende Literatur:
Heim, Susanne (bearb.): Deutsches Reich 1938 – August 1939, (= Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933–1945, hrsg. Bd. 2), München 2009.
Lepper, Herbert: Von Der Emanzipation zum Holocaust. Die israelitische Synagogengemeinde zu Aachen 1801-1942, Aachen 1994.