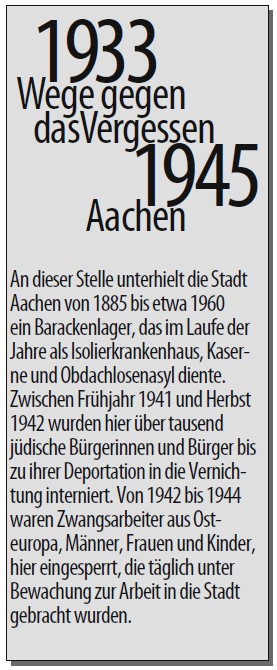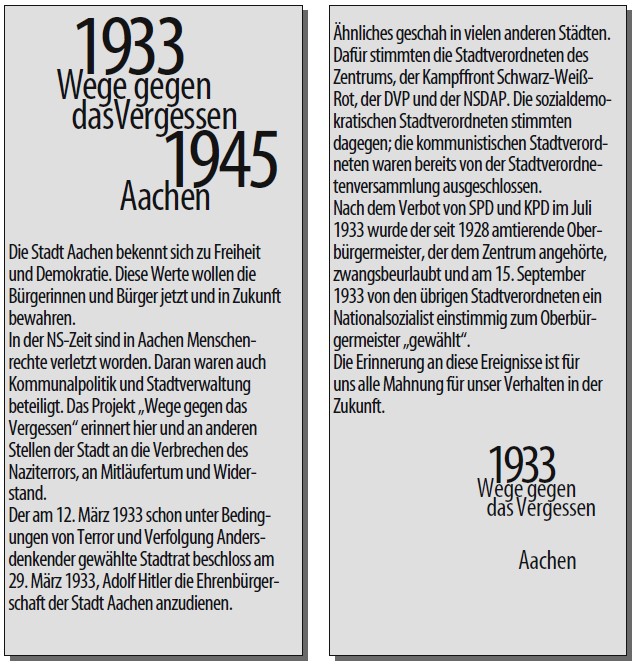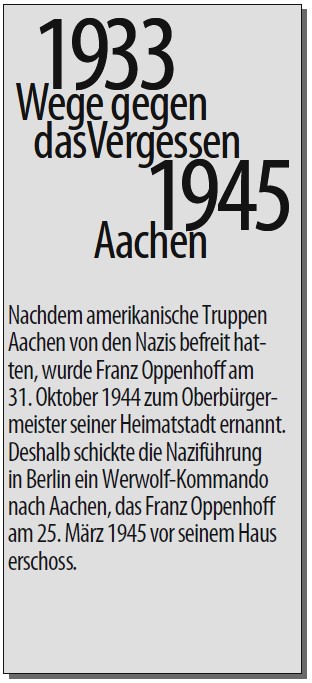Aktuelles
Etablierung der NS-Herrschaft
Vor 1933 spielte die NSDAP in Aachen eine eher unbedeutende Rolle. Zwar hatte sich schon 1922 eine Ortsgruppe gegründet, die aber auch in den folgenden Jahren kaum mehr als 30 Mitglieder hatte. In diesen Jahren fanden die Nazis in Aachen kaum einen Wirt, der ihnen einen geeigneten Saal für Versammlungen vermietet hätte. Nach dem Abzug der belgischen Besatzung ende 1929 wurde die Ortsgruppe in ihrem Auftreten deutlich aggressiver. Es begann eine Zeit tätlicher Auseinandersetzungen, Schlägereiern, mit denen die Nazis gegen ihre politischen Gegner vorgingen.
Am 28. Juli 1932 fand auf der Radrennbahn Krummerück eine Wahlkampfveranstaltung mit Adolf Hitler statt. Es war, mit etwa 15.000 bis 20.000 Teilnehmern, eine der größten Wahlkampfveranstaltungen, die Aachen in der damaligen Zeit zu sehen bekam.
Nach der Regierungsübergabe 1933 kam die NSDAP in Aachen auf etwa 1.500 Mitglieder, in der gesamten Region waren es knapp 5.000. Obwohl die Wahl zum Stadtrat am 12. März 1933 schon nicht mehr demokratisch ablief, denn die SPD konnte nicht mehr frei ihren Wahlkampf machen und die KPD war schon verboten, holten die beiden Arbeiterparteien noch einen erheblichen Stimmenanteil. Das Zentrum mit 23 Sitzen hatte am besten abgeschnitten. Allerdings kam die Stadtverordnetenversammlung in der gewählten Konstellation nie zusammen.
Das Zentrum, die katholische Partei, die noch am 29. März 1933 der Verleihung der Ehrenbürgerwürde an Adolf Hitler zugestimmt hatte, musste sich bald selbst auflösen. Eine Reihe ihrer Ratsmitgliedern trat damals der NSDAP-Fraktion bei. Der Oberbürgermeister wurde schon bald durch den NS-Bürgermeister Quirin Jansen (1888 - 1953) ersetzt. Die SPD wurde wie zuvor die KPD verboten.
Nachdem die Gewerkschaften am 1. Mai 1933 noch versucht hatten, sich mit den Nazis zu arrangieren, wurden sie als Organisationen der Arbeiterschaft am 2. Mai verboten und ihr Vermögen beschlagnahmt. Schritt für Schritt übernahmen die Nationalsozialisten die komplette Entscheidungsgewalt in Aachen. Fast alle Bereiche wurden durch sie kontrolliert. Auch in Aachen sorgten von da an die Nazis dafür, dass die in Berlin erlassenen Gesetze und Verordnungen gegen Andersdenkenden, Andersgläubige und Andersartige gnadenlos durchgeführt wurden. Daran waren auch Stadtrat und Stadtverwaltung beteiligt – in Aachen und anderswo. Dass dies alles so geschehen konnte, lag auch daran, dass sich die Nazis auf zahlreiche willfährige Helfer und Mitläufer verlassen konnten.
Ergänzende Literatur:
Casteel, Winfried; Hugot-Zgodda, Yvonne: Nazis an der Macht, in: Volkshochschule Aachen (Hrsg.): Beiträge zur Geschichte des Nationalsozialismus in Aachen,
Aachen 2012.
Gasten, Elmar: Aachen in der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft 1933 - 1944, Frankfurt am Main 1993.
Kirschgens, Albert; Spelsberg, Gerd: Einigkeit statt Recht und Freiheit. Aachen 1933, Aachen 1983.
Pehle, Walter H.: Die nationalsozialistische Machtergreifung im Regierungsbezirk Aachen unter der Berücksichtigung der staatlichen und kommunalen Verwaltung
1922 - 1933, Diss., Düsseldorf 1976.
Plum, Günther: Gesellschaftsstruktur und politisches Bewusstsein in einer katholischen Region 1928 - 1933. Untersuchungen am Beispiel des Regierungsbezirks Aachen,
Stuttgart 1972.
GESTAPO
GESTAPO ist die Abkürzung für „Geheime Staatspolizei“ die gängige Bezeichnung für die politische Polizei im nationalsozialistischen Deutschland zwischen 1933 und 1945. Die GESTAPO war ein zentrales Ausführungsorgan der nationalsozialistischen Herrschaft und als solches verantwortlich für die organisierte und institutionalisierte Verfolgung von vermeintlichen 'Staatsfeinden' in Deutschland und während des 2. Weltkrieges von Deutschland besetzten Gebieten.
Im April 1933 wurde auf Veranlassung von Göring das Geheime Staatspolizeiamt als politische Polizei des neuen Regimes eingerichtet. Im Juni 1936 wurde sie Reichsbehörde. Hatten die Staatspolizeistellen anfangs noch ihre Maßnahmen mit der Reichstagesbrandverordnung und anderen Vorschriften zur Stabilisierung der politischen Lage begründet, gewannen sie zunehmend an außerjuristischen Kompetenzen, die sie selbst vollstrecken konnten. Sie verhängte „Schutzhaft“, konnte Aussagen durch Folter ('verschärfte Vernehmung') erzwingen und mit immer weiter steigender Machtkompetenz in den Kriegsjahren ohne Gerichtsverhandlung Gefangene ermorden ('Sonderbehandlung'). Unter die Zuständigkeit der GESTAPO fiel die systematische Bekämpfung von tatsächlichen oder vermeintlichen politischen Gegner*innen des NS-Regimes. Die Effektivität der GESTAPO beruhte, trotz eines relativ überschaubaren Personalstammes, auf einem ausgedehnten Überwachungsnetzwerk aus V-Personen und Zuarbeit vonseiten der Bevölkerung sowie Parteiinstitutionen und städtischen Behörden.
Die Staatspolizeistelle Aachen hatte ihren Sitz hauptsächlich im Nebentrakt des ehemaligen Regierungsgebäudes am Theaterplatz 14 / Ecke Borngasse. Mit dem Vorrücken der Alliierten Truppen verließen die letzten Angehörigen der Außendienststelle Aachen am 10. September 1944 die Stadt Richtung Norden. Im Rahmen der sogenannten Endphaseverbrechen beteiligten sich Angehörige der Aachener Außendienststelle an der Erschießung von Zwangsarbeiter*innen, Deserteuren, Frontgänger*innen und Gegner*innen des NS-Regimes.
Ergänzende Literatur:
Porger, Rene: Erste Forschungsergebnisse der NS-Dokumentationsstätte, in: Wege gegen das Vergessen. Zeitschrift der NS-Dokumentationsstätte Aachen, Ausgabe 1,
Aachen 2023.
Kraus, Thomas; Thomes, Paul: Zwangsarbeit in der Stadt Aachen. Ausländereinsatz in einer westdeutschen Grenzstadt, Aachen 2002.
Franz Oppenhoff
Franz Oppenhoff wurde 1902 geboren. Er stammte aus einer gut bürgerlichen, katholischen Aachener Familie. Nach einer kaufmännischen Ausbildung studierte er Jura und ließ sich Ende 1932 in Aachen als Rechtsanwalt nieder. Er geriet nach der Regierungsübergabe an die Nationalsozialisten immer stärker in Konflikt mit der NSDAP, weil er bei verschiedenen Gelegenheiten das Bistum Aachen in Prozessen, die von den Nazis gegen Geistliche inszeniert wurden, vertrat. Die Kirchenzeitung veröffentlichte 1937 eine Erklärung des Papstes, in der dieser sich kritisch über die Lage der katholischen Kirche in Deutschland geäußert hatte. Daraufhin sollte der Verlag der Zeitung geschlossen werden. Oppenhoff vertrat den Besitzer vor Gericht, was ihn für die Nazis besonders verhasst machte.
Durch gute Beziehungen schaffte er es, dass er im 2. Weltkrieg nicht in die Wehrmacht musste, sondern als kaufmännischer Direktor bei dem wichtigen Rüstungsbetrieb Veltrup in Aachen arbeiten konnte. Als die amerikanischen Truppen Aachen im Oktober 1944 einnahmen, setzten diese kurze Zeit danach Franz Oppenhoff auf Vorschlag des Aachener Bischofs als Oberbürgermeister ein.
„Es gibt nichts mehr zu verwalten, alles und jedes ist neu zu erarbeiten. Die Aufgabe scheint hoffnungslos und geht fast über unsere Kraft,“ so äußerte sich Oppenhoff kurz nach seiner Amtsübernahme. Obwohl der Name des neuen Aachener Oberbürgermeisters von den Amerikanern nicht bekannt gegeben worden war, erfuhr ihn die Naziführung im fernen Berlin. Sie betrachteten Oppenhoff als Verräter und entsendeten ein sogenanntes Wehrwolfkommando, das Oppenhoff ermorden sollte. Die fünf Mitglieder dieses Kommandos, von denen zwei ortskundige Mitarbeiter der Aachener Staatspolizeistelle waren, sprangen nachts mit dem Fallschirm in der Nähe von Aachen ab.
Am 25. März 1945 wurde Franz Oppenhoff von diesem Wehrwolfkommando vor seinem Haus in der Eupener Straße 249 erschossen. Aachen war damals schon fast ein halbes Jahr im Wiederaufbau, während in Deutschland der Krieg noch bis Mai 1945 weiterging. 1949 und 1952 wurden Prozesse gegen die Mörder geführt, in denen milde Gefängnisstrafen verhängt wurden. Den Tätern wurde strafmildernd die Entlastungsbehauptung angerechnet, dass es ein 'nicht zu erwartendes Maß an Charakterstärke' erfordert hätte, sich dem Befehl zu Oppenhoffs Ermordung zu widersetzen, obwohl Aachen zu dem Zeitpunkt schon fast ein halbes Jahr von den Alliierten befreit gewesen ist. Die juristische Behandlung des Mordfalls Oppenhoff verdeutlicht, wie sehr das Gericht der Selbstschutzbehauptung der Angeklagten folgten. 1954 wurde allen Tatbeteiligten jegliche Reststrafe erlassen.
Ergänzende Literatur:
Heer, Hannes: Der Mordfall Oppenhoff. Werwölfe auf den Trümmern des Nazireiches, Dokumentarfilm, WDR 1985.
LAV NRW, Ger. Rep. 0089, Nr. 37.
Padover, Saul K.: Experiment in Germany. The Story of an American Intelligence Officer, New York 1946.
Trees, Wolfgang; Whiting, Charles: Unternehmen Karneval. Der Werwolf-Mord an Aachens Oberbürgermeister Oppenhoff, Aachen 1982.
52 Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung
Im Süden von Aachen gelegen erreicht man den Waldfriedhof von Burtscheid kommend über die Kapellen- und Robert-Schumann-Straße, die ab Siegel in die Monschauerstraße übergeht. Dieser folgt man, bis man auf der linken Seite den Parkplatz des Waldfriedhofs erreicht.
Im August des Jahres 1962 wurden 52 Urnen mit den sterblichen Überresten von Verfolgten des nationalsozialistischen Regimes, die bis dahin auf verschiedenen Aachener Friedhöfen bestattet waren, auf dem Ehrenfriedhof (Flur 8b) beigesetzt. Sie wurden auf einer Gemeinschaftsanlage des Ehrenfriedhofes zusammengefasst. Jedes Urnengrab erhielt einen sog. Kissenstein, so dass die gesamte Anlage eine einheitliche und würdige Ausgestaltung erfuhr.
Bei den Verstorbenen handelte es sich etwa zur Hälfte um politisch Verfolgte. Auch ruhen hier verfolgte queere Menschen und Menschen, die Opfer der Euthanasie-Morde wurden. Sie kamen in verschiedenen Konzentrationslagern und Tötungsanstalten ums Leben oder wurden ermordet. Die 52 Urnen der Verstorbenen wurden in den Jahren 1941 bis 1943 an die Stadt Aachen überführt.
1986 wurde ein Pultstein mit einer ersten Gedenktafel aufgestellt. Die Inschrift lautete:
„Hier ruhen 52 Opfer nationalsozialistischer Gewaltherrschaft – sie mahnen uns“.
2003 wurde diese Tafel ersetzt durch eine Tafel der Wege gegen das Vergessen, die die Herkunft der Opfer, die dort ruhen, genauer benennt:
"Hier ruhen 52 Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Unter ihnen sind politisch Verfolgte, Homosexuelle und behinderte Menschen."

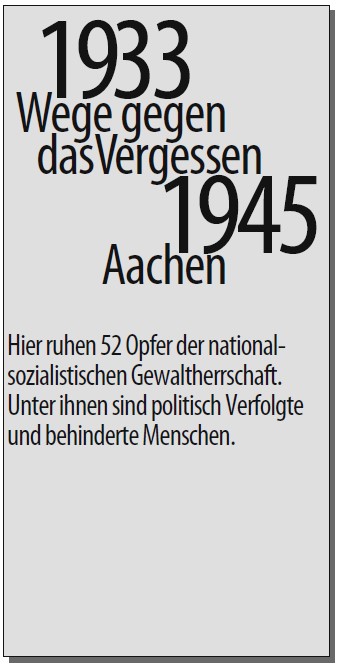
Kriegsopfer
Der Ehrenfriedhof auf dem Waldfriedhof an der Monschauerstraße ist Gedenkstätte für die Gefallenen des 1. und 2. Weltkrieges. Am 12. September 1914 beschloss die Stadtverordnetenversammlung einen Ehrenfriedhof an dieser Stelle anzulegen. Zu dieser Zeit befand sich dort lediglich der Bismarckturm, ein Ausflugsziel im Wald. Der heutige Friedhof wurde 1930 eingerichtet und 1933 die Einsegnungshalle fertiggestellt. 2455 deutsche und ausländische Kriegstote finden zwischen August 1914 und Januar 1923 hier ihre letzte Ruhestätte.
Mit Ausbruch des zweiten Weltkrieges und den damit verbundenen Toten wird der Friedhof im November 1939 erweitert. Zu den dort 2.623 Ruhenden zählen auch Opfer alliierter Bombardements und 52 Verfolgte des nationalsozialistischen Regimes. Die Toten aus 16 Nationen haben hier ewiges Ruherecht. Im Oktober 1957 wurde inmitten des Ehrenfriedhofes ein 6,20 hohes Steinkreuz aus belgischem Granit aufgestellt, ursprünglich wurde dieses Hochkreuz für den Soldatenfriedhof in Ougrée-Boncelles gestiftet, da dort deutschen Soldaten beigesetzt waren.
Nachdem man die deutschen Soldaten auf andere Soldatenfriedhöfe umbettete, wurde das Hochkreuz nach Aachen gebracht.
Kriegsende
Im Januar 1941 wurde an verschiedenen Stellen in der Stadt mit dem Bau von Bunkern begonnen. Für den Bau war die städtische Bauverwaltung verantwortlich, welche die Aufträge an ortsansässige Firmen vergab, diese setzten meist Zwangsarbeiter für den Bau ein. Die Bunker wurden nie völlig fertig gebaut. Sie gaben der Bevölkerung Schutz vor Angriffen.
In den letzten Kriegstagen in Aachen drangen die amerikanischen Truppen mit zunehmender personaler und materieller Überlegenheit immer weiter in den Stadtkern vor. Der verbliebene Kommandeur der Kampfgruppe Aachen, Oberst Gerhard Wilck verteidigte mit weniger als 1.000 Mann ein immer weiter zusammenschrumpfendes Gebiet am Lousberg. Hier diente ihm der Bunker in der Rütscher Straße als Gefechtsstand, die militärische Führungsstelle für das Gefecht.
Die verbliebenen Soldaten um Wilck, motiviert von ihrem an Fanatismus grenzenden Glauben an den sog. Endsieg, in einer militärisch aussichtslosen Lage um ein wenige hundert Quadratmeter fassendes Gebiet zwischen Lousberg und Ponttor. Am 19. Oktober richtete Wilck noch folgenden Tagesbefehl an die verbliebenen Soldaten:
„Die Kampfgruppe von Aachen rüstet sich zu ihrem letzten Kampf. Auf engstem Raum zusammengedrängt wird sie sich gemäß dem Befehl des Führers bis zum letzten Mann, bis zur letzten Granate und bis zur letzten Patrone verteidigen.“(1)
Wenige Tage später am 21. Oktober als die Lage an militärischer Asymmetrie nicht mehr zu überbieten war, setzt er eine letzte Nachricht ab:
„Nach verbissenstem Ringen Haus um Haus, Mann um Mann hat die Kampfgruppe Aachen letzte Munition verschossen, Wasser und Verpflegung aufgebraucht. Reste der Verteidiger der Kaiserstadt stehen im Nahkampf am Gefechtsstand. (…) Vorher gilt letzter Gruß in unerschütterlichem Glauben an unser Recht und unseren Sieg unserer geliebten deutschen Heimat. Es lebe der Führer! [sic!]“(2)
Keine Stunde nach dieser Bekennung zum NS-Regime wich Wilck, den eigenen Tod vor Augen, jedoch von seiner Einstellung, bis zum letzten Mann zu kämpfen, ab verließ den Bunker in der Rütscher Straße und kapitulierte. Er ging mit den verbliebenen 300 Soldaten in Kriegsgefangenschaft.(3)
Seit 2002 hing an dem Bunker in der Rütscher Straße eine Gedenktafel der Wege gegen das Vergessen. Diese Tafel musste 2013 abgenommen werden, da der Bunker abgerissen wurde, um dort Wohnungen zu errichten. Nach der Fertigstellung der Wohnbebauung wurde im Juli 2019 die Tafel dort angebracht.
Außer den Hochbunkern gab es noch unterirdische Stollen und Splitterschutzgräben. Bunker gab es in der Monheimsallee (unterirdische), Römerstraße, Südstraße, Kongressstraße, Saarstraße, Fringsgraben, Junkerstraße, Sandkaulstraße, Kasinostraße, Zeppelinstraße, Scheibenstraße, Lütticher Straße, Rütscherstraße, Försterstraße und Rehmannstraße. Nach dem Krieg dienten einige Bunker als Wohnungen, bis heute sind einzelne von ihnen noch im Stadtbild zu finden, z.B. als Musikbunker, umgebaut zu Wohnungen oder als leerstehende Gebäude.
(1) BArch, RH 24-81/111, Bl. 52.
(2) BArch, RH 24-81/111, Bl. 56.
(3) Wilck, Gerhard: Die 246. Volks-Grenadierdivision in der Zeit von September bis November 1944, in: Poll, Bernhard (Hrsg.): Das Schicksal Aachens im Herbst 1944, in: Sonderdruck ZAGV, Bd. 73 (1961), Aachen 1962, S. 121.
Ergänzende Literatur:
Heckmann, Dieter: „Halten bis zum letzten Mann…“. Der Kampf um Aachen im Herbst 1944, Aachen 2003.
Wilck, Gerhard: Die 246. Volks-Grenadierdivision in der Zeit von September bis November 1944, in: Poll, Bernhard (Hrsg.): Das Schicksal Aachens im Herbst 1944, in: Sonderdruck ZAGV, Bd. 73 (1961), Aachen 1962.


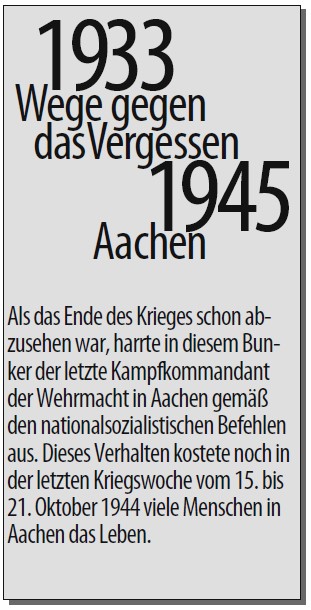
„Westwall“
Nach den Erfahrungen des Ersten Weltkrieges bauten in den 20er und 30er Jahren viele Staaten ihre Grenzbefestigung aus. Mit dem Austritt aus dem Völkerbund und dem Bruch des Versailler Vertrages während des Nationalsozialismus, wird auch begonnen mit der Planung und dem Ausbau der Grenzbefestigungen im Westen. Im Oktober 1938 gab Hitler den Befehl Aachen mit in den Westwallbau einzubeziehen. Bereits einige Tage später erging entsprechende Weisung an die Organisation Todt den Plan umzusetzen.
Im Mai 1939 kamen Hitler und Himmler nach Bildchen und Köpfchen um den Westwallbau zu besichtigen. Beim Vormarsch der Alliierten auf Aachen konnte der Westwall die Alliierten nur kurz aufhalten. Nach dem Krieg wurden Teile des Westwalls zum Wiederaufbau von Gebäuden, Zäunen usw. genutzt. Bis heute sind Teile des Westwalls zu entdecken: einige sind mit Erde bedeckt, mit Bäumen bepflanzt oder offen zu sehen, vielen Landwirten erschwert die Höckerlinie immer noch die Arbeit auf dem Feld.
Ergänzende Literatur:
Karola Fings, Frank Möller (Hrsg.): Zukunftsprojekt Westwall. Wege zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit den Überresten der NS-Anlage, Weilerswist 2008.
Militarismus
Fast genau in der Mitte der Ludwigsallee, an ihrem höchsten Punkt, steht als Teil des zweiten städtischen Mauerringes, der mächtige Rundbau der Marienburg. Seinen Namen erhielt er in Erinnerung an die Grundsteinlegung am 14.08.1512 am Vorabend des Festes 'Maria Himmelfahrt'. Die Bastion bot Platz für schwere Geschütze, die die Stadt vor feindlichen Angriffen von den gegenüberliegenden Höhenzügen schützen sollte. 1638 eroberten die spanischen Truppen des Generals Marquis de Grana die Marienburg. Seither sind auf der Feldseite Mauerwerksblöcke mit halbrund herausgemeißelten Kugeln eingelassen, die es als eine Art 'Kriegerdenkmal' ausweisen.
Schon um 1929 gab es Pläne, dort eine Gedenkstätte für die toten Soldaten des 1. Weltkrieges, die aus Aachen stammten, zu errichten. Aber erst während der NS-Herrschaft wurde dieser Bau realisiert. Im Inneren blickt man auf den zentralen Gedenkstein, der an ein mittelalterliches Grabmal erinnert und auf der Oberseite die Konturen eines Soldaten in Uniform zeigt. Auf einem gedrungenen Sockel an der Rückwand steht eine bronzene Schale, in der lange Zeit ein ewiges Licht brannte.
Die Einweihung der Marienburg als „Ehrenmal“ fand am 6. August 1933 statt - ein halbes Jahr, nachdem Hitler als Reichskanzler in Berlin die Macht übernommen hatte. Die markige, von Militarismus geprägte Eröffnungsrede hielt Aachens damaliger NSDAP-Oberbürgermeister Quirin Jansen:
„Zu Tausenden strömen sie in diesen Tagen zum Ehrenmal des Westens, zur Aachener Kriegergedächtnisstätte, dem Marienturm, um dort das Andenken an die Kameraden zu erneuern, die mit ihnen im feldgrauen Rock hinauszogen zum Schutz des Vaterlandes, und die nicht wiederkehrten, als das blutige Ringen zu Ende war. Frontgeist verbindet sie noch heute, die Lebenden und die Toten des großen Krieges. Frontgeist wirbt um alle deutschen Herzen. Aus dem Samen der Schlachtfelder wächst deutsche Zukunft. Aachen neigt sich in Dankbarkeit vor den toten Soldaten und grüßt die Lebenden: Siegheil! [sic!]“
Beteiligt an dieser Einweihungsfeier waren auch Studenten verschiedener Studentenverbindungen, die im Rahmen des Deutschen Studententages Anfang August 1933 in Aachen waren. Gemeinsam mit Abordnungen der NSDAP, der SS, der SA und des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes marschierten sie mit großem Gepränge zum 'Ehrenmal'.
Im 2. Weltkrieg wurde die Marienburg schwer beschädigt. 1955 wurde sie – ganz im alten Stil und im alten Geist - wieder als 'Ehrenmal' eingeweiht. Auf der damals neu angebrachten Hinweistafel wird die ursprüngliche Einweihung der Gedenkstätte durch den NS-Oberbürgermeister Jansen nicht erwähnt. Bis 1992 fanden an dieser Stelle am Totensonntag, also dem Sonntag nach dem 'Volkstrauertag', an dem aller Opfer der Kriege und der NS-Zeit gedacht wurde, sog. 'Heldengedenkfeiern' militärischer Traditionsverbände statt. Dort versammelten sich neben Politiker*innen und Bundeswehr teilweise auch rechtsextreme und geschichtsrelativierende Organisationen.
Ergänzende Literatur:
Helg, W.: Geschichte der Marienburg, Aachener Anzeiger, 01.06.1932.
o. A.: Den Toten Helden geweiht!, Aachener Anzeiger, 07.08.1933.
Poll, Bernhard: Geschichte Aachens in Daten, Aachen 2003, S. 312.

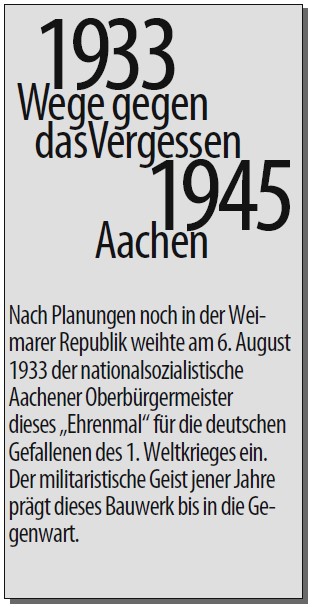
Das Lager
Am Grünen Weg waren 1885 Holzbaracken errichtet worden, die nacheinander als Seuchenlazarett, als Kaserne und Ende der zwanziger Jahre als Obdachlosenheim verwendet wurde. Während des 2. Weltkrieges waren hier Jüdinnen und Juden aus der Region interniert, später dann auch Zwangsarbeiter untergebracht. Ab April 1941 mussten die jüdischen Aachener*innen spätestens ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Sie wurden gezwungen, in sogenannte Judenhäuser zu ziehen. Das waren größere und kleinere Gebäude, die als Zwangsunterkünfte eingerichtet worden waren und nicht selten zuvor "arisiert" wurden. "Judenhäuser" befanden sich in Aachen in der Alexanderstraße, der Königstraße, der Eupener Straße, der Promenadenstraße, der Theaterstraße, der Försterstraße, im Drosselweg und auf Kalverbenden. Die Menschen lebten hier unter unvorstellbaren Bedingungen. Die Zimmer waren überbelegt, es gab nicht genügend Toiletten und fast keine Küchen.
Das vormalige Obdachlosenheim am Grünen Weg wurde in ein ”Judenlager” umfunktioniert. In den heruntergekommenen Holzbaracken, mit völlig unzureichenden Sanitäranlagen und ohne jegliche Luftschutzmaßnahmen, verbrachten viele Jüdinnen und Juden ihre letzten Wochen und Monate bevor sie deportiert wurden. Insgesamt sieben Deportationstransporte gingen von Aachen aus, davon vier mit Menschen, die zuvor im „Lager Grüner Weg“ waren. Am 22. März 1942 wurden Menschen aus dem Lager zum Westbahnhof gebracht, von dort aus fuhr der Zug in das Durchgangslager Izbica.[1] Ob einer die Strapazen der langen Fahrt und die alltäglichen Quälereien im Lager überlebt hat, ist nicht bekannt.
Nachdem Ende 1942 die letzten jüdischen Aachener aus dem Lager Grüner Weg abtransportiert worden waren, wurden andere Menschen dort eingesperrt: Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen. Die waren meist aus den von der Deutschen Wehrmacht besetzten Ländern in Osteuropa, zum Beispiel Polen und der damaligen Sowjetunion, zur Arbeit nach Deutschland verschleppt worden. Das „Lager Grüner Weg“ befand sich in unmittelbarer Nähe zu den großen Industriebetrieben an der Jülicher Straße, in denen viele der Zwangsarbeiter*innen arbeiten mussten. Bis Kriegsende waren hier bis zu 250 Zwangsarbeiter*innen untergebracht. Zu Fuß und natürlich streng bewacht marschierten sie jeden Morgen vom Appell im Lager zum Arbeitseinsatz in die verschiedenen Betriebe und auf die Baustellen in der Stadt.
Polnischen und russischen Zwangsarbeiter*innen war es bei Strafe verboten, bei Luftangriffen in Bunkern Schutz zu suchen. Am 7. Juli 1944 wurden auf Befehl des Leiters der Außendienststelle Aachen der Staatspolizeistelle Köln, Kriminalrat Richard Bach, im Lager Grüner Weg neun Personen erhängt, eine weitere Hinrichtung hatte drei Tage zuvor stattgefunden.[2] Es sollte ein Exempel statuiert werden, um die Menschen einzuschüchtern, denn die Nachricht von der Landung der Alliierten in der Normandie hatte die Hoffnung auf baldige Befreiung genährt.
[1] Online abrufbar unter: 22.03.42 nach Izbica (statistik-des-holocaust.de)
[2] Vgl. Kraus, Thomas; Thomes, Paul: Zwangsarbeit in der Stadt Aachen. Ausländereinsatz in einer westdeutschen Grenzstadt, Aachen 2002, S. 130.
Ergänzende Literatur:
Lepper, Herbert: Von Der Emanzipation zum Holocaust. Die israelitische Synagogengemeinde zu Aachen 1801-1942, Aachen 1994.
Kraus, Thomas; Thomes, Paul: Zwangsarbeit in der Stadt Aachen. Ausländereinsatz in einer westdeutschen Grenzstadt, Aachen 2002.
Weinmann, Martin (Hrsg.): Das nationalsozialistische Lagersystem (CCP), Frankfurt am Main 1998.